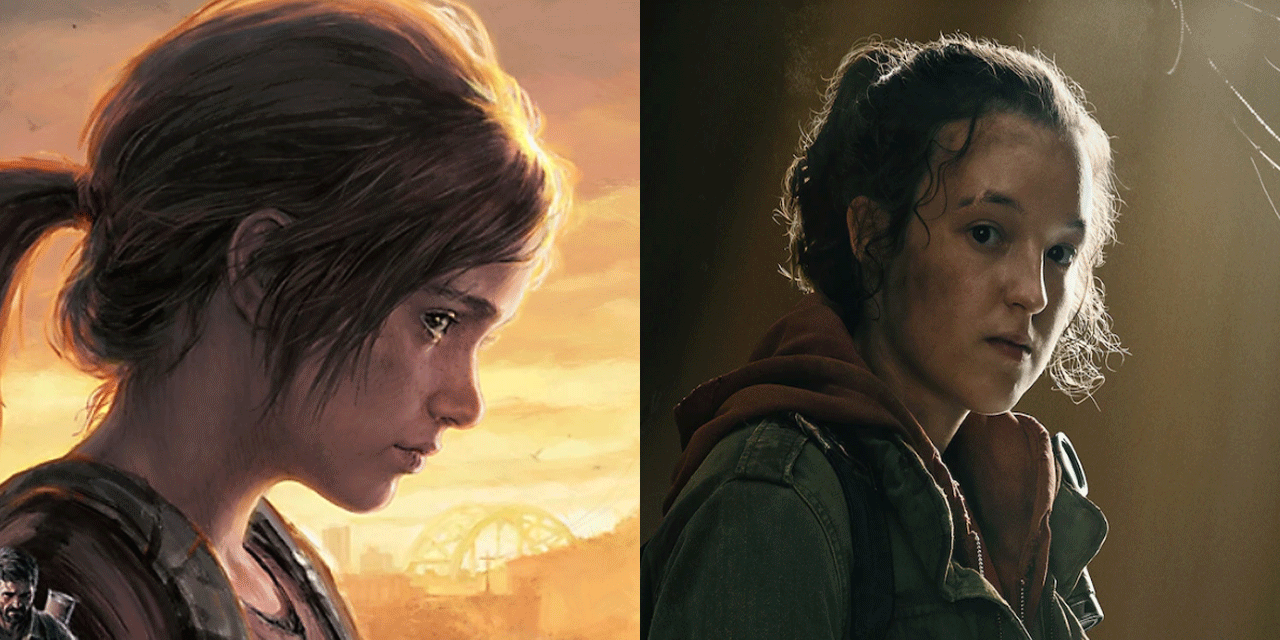Bekenntnisse eines Nicht-Gamers
Von Christian Fuchs
Am Anfang war das Vorurteil. Als die ersten Lobeshymnen zur Videospiel-Verfilmung „The Last of Us“ eintrudelten, schaltete ich auf Durchzug. Trotz meiner Wertschätzung für HBO, einen echten Qualitätskanal im Seriendschungel. Ein Teil meiner Skepsis speiste sich aus der Grundidee. Schon wieder Zombie-Apokalypse (gefühlt das inflationärste aller Horrorgenres) und dann auch noch ein odd couple im Mittelpunkt, das sich durch die Endzeit kämpft, wie in Cormac McCarthys „The Road“, einem todernsten, berührenden Roman, der nicht nur mir heilig ist.
Und dann eben das Unwort: Videospiel-Verfilmung. Fällt der Begriff im FM4 Film Podcast, werfen Kollegin Pia Reiser und ich uns Blicke zu, als ob wir in Zitronen gebissen hätten. Ich weiß nicht, in wie vielen schrottigen Streifen ich (beruflich!) gesessen bin, die diesen Stempel trugen. Am schlimmsten sind mir die letzten Teile der „Resident Evil“ Saga in Erinnerung, in 3D, wo ich im Kinosessel herumrutschte, unfassbar gelangweilt und aufgekratzt zugleich, im im Dunkeln auf die Uhr blickend, wann ich denn die sinnentleerte Bilderhölle verlassen darf.

HBO
Langsames Indie-Drama für Millionenpublikum
Um zum Punkt zu kommen: Die Serie „The Last of Us“ radiert solche Vorurteile aus, zumindestens meinerseits. Obwohl (oder gerade weil) der Game-Creator Neil Druckmann direkt involviert war, zusammen mit „Chernobyl“-Showrunner Craig Maizin, pulversiert die erste Staffel sämtliche negativen Erwartungen.
Statt hektisch geschnittener Action, kompletter Überzogenheit und austauschbaren Spielfiguren bekommen wir das Gegenteil serviert. Ganz viel Langsamkeit. Fast schon unheimlich gutes Schauspiel (Bella Ramsey!). Brutalen Realismus. Und als Schlagobers-Häubchen kreative Monstereffekte. „The Last of Us“ ist ein künstlerisch hochwertiger Serien-Meilenstein, der zum Mega-Hit wurde. Die Apokalypse als bedächtig erzähltes Indie-Drama für ein Millionenpublikum, fantastisch.
Auch Rainer Sigl, eigentlich primär Games-Fan, kann der Serie viel Gutes abgewinnen. Er meint, dass das vielleicht sogar ein kleines bisschen gegen das Spiel spricht.
Ein paar begeisterte Facebook-Postings meinerseits später musste ich erkennen, dass die einzige (marginale) Kritik an der Serie aus Gamerkreisen kam. Den einen scheint die HBO Show zu langsam, sie goutieren eben die Slowburn-Momente, wo sich ganze Episoden wie ein emotionales Sundance-Movie anfühlen, überhaupt nicht. Andere finden „The Last of Us“ als Serie tatsächlich zu schnell. Weil sie eben selber ganze Nächte mit gewissen Spielsituationen verbrachten, die in der Streamingfassung nebenbei passieren.
Das Reizwort Interaktivität
Deshalb hier einige Grundsätzlichkeiten zum Unterschied zwischen Spielen und Filmen/Serien, die Gaming-Community mag den polemischen Unterton verzeihen. Ich klammere dabei den Faktor „Zeit“ mal aus, die ist ohnehin ultrakostbar. Und die fehlt meiner gehetzten Wenigkeit auch für so viele Filme und vor allem Serien. Lasst mich das Thema „Ästhetik“ ebenso ignorieren, sogar mir als Verweigerer ist bewusst, dass gelungene Games mittlerweile auf einem hohen visuellen Level funktionieren. (Auch wenn Joel und Ellie im Spiel viel zu glatt und unglaubwürdig ausschauen, psst).
Anyway, mein grundsätzliches Problem ist das Reizwort Interaktivität. Ganz zentral bei Film und Serien ist das Zurücklehnen, das Fallenlassen in eine Erzählung, eine Welt, die sich andere Menschen ausgedacht haben. Film ist Selbstaufgabe. Mehr noch: Film ist ein Akt der Auslieferung.
Trotzdem: Passiv ist diese Haltung nur scheinbar, denn je besser, aufregender, mitreißender Filme/Serien sind, desto mehr stimulieren sie die Gedanken und auch den Körper. Wie bei einem Spitzenkonzert, wo du in die Musik kippst, die Texte eventuell kreative Explosionen in deinem Kopf auslösen und du gleichzeitig tanzt und vibrierst. Der ganze riesige Bereich des Body Cinema sorgt ja für Zittern, Erregung, Tränen. Filme und Serien gehen im besten Fall unter die Haut. Und man will, zumindest ich, danach Songs schreiben, Podcasts aufnehmen, zumindest mit Freund*innen ausführlich darüber reden. Wenn wer bei Filmen und Serien von „Berieselung“ spricht, entgegne ich gerne mit dem Wort „Inspríration“.
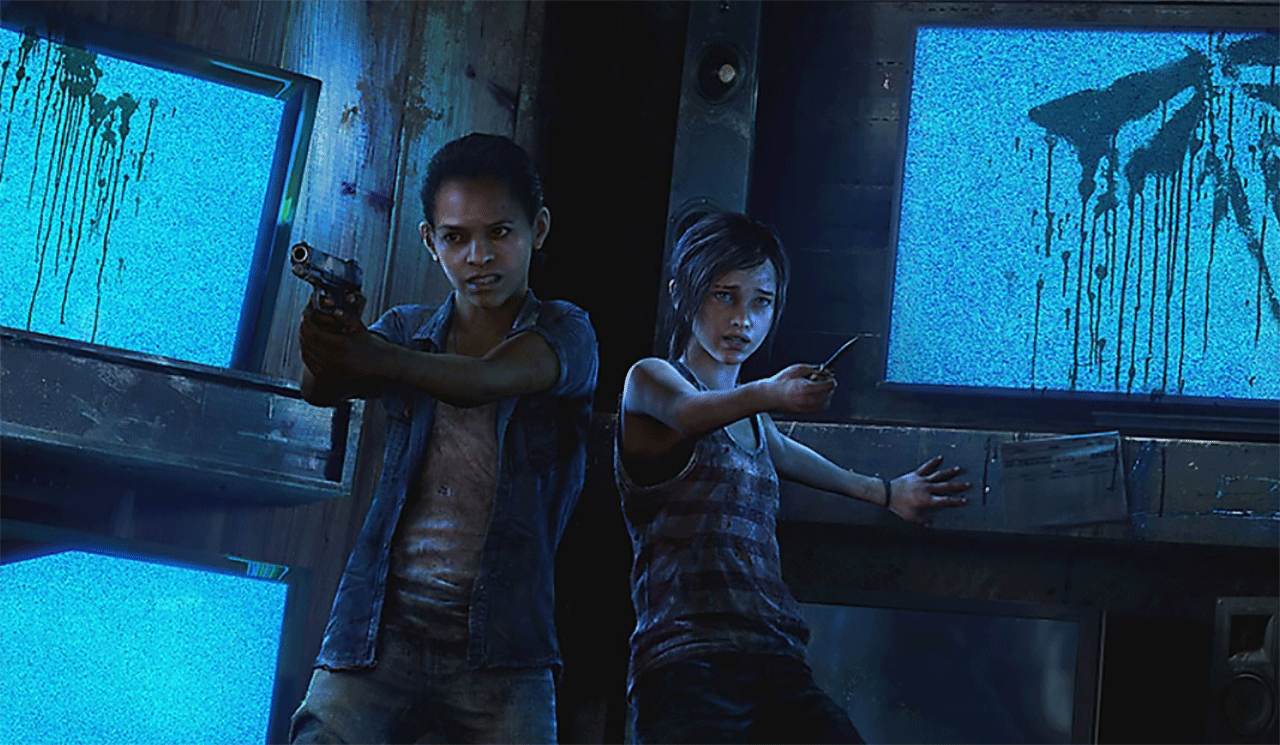
Naughty Dog
Blicke, Gesten, Gesichter statt Challenges
Jetzt wird es entschieden persönlich. Als prinzipieller Kontrollfreak liebe ich es gerade, Kontrolle abzugeben, mich der Fantasie von Filmemacher*innen zu überlassen, deren Entscheidungen zu akzeptieren - oder eben nicht. Das mag man als entspannend oder erlösend bezeichnen, ich verwende gerne auch das pathetische Wort „kathartisch“.
Dieses sich-fallenlassen und von vertrauensvollen Filmemacher*innen aufgefangen zu werden, hat jedenfalls etwas enorm Lustvolles (auch bei total verstörenden Filmen). Games bringen dagegen den interaktiven Ansatz ins, ja, Spiel.
Du arbeitest dich durch eine Abfolge von Situationen durch, bist Teil davon, sogar mittendrin. Aber nur vermeintlich. Denn du folgst vorgegebenen Wegen und Challenges, die sich Programmier*innen ausgedacht haben. Es geht um komplett andere Aspekte wie beim Film, ich sage jetzt mal vorsichtig: Unter anderem um Logik, Risikobereitschaft, Geschicklichkeit (und exkludiere dabei den Kitzel der bloßen Shooter-Spiele).
Filme oder Serien - und jetzt greife ich aktuelle cinephile Diskurse auf - leben aber im Idealfall davon für eine gewisse Dauer Logik und erfolgsorientiertes Denken hinter sich zu lassen. Und stattdessen - Achtung, Kitschalarm - sich dem Herz, dem Gefühl, dem Inneren von Figuren zu nähern. Blicke zu studieren, sich in Gesten und Gesichter mancher Akteur*innen zu verlieben.
Oder auch moralische und ethische Entscheidungen zu reflektieren (die finale Folge von „The Last of Us“ toppt diesbezüglich das Burgtheater-Repertoire).
Die Reise ist das Ziel
OK, ich bin befangen, ich wollte einmal ein ganzes Buch gegen „Interaktivität“ schreiben - und wie der neoliberale Kapitalismus mit dieser Lüge der Unterhaltungs-Industrie viele Menschen ruhigstellt. Deshalb noch kurz zur modernen Sicht auf Filme und Serien: Was Gamern verständlich so essentiell ist - der Weg von A nach B und die Herausforderungen dabei - ist für viele Filmkünstler*innen nebensächlich geworden. „Handlung“ wird in einer Ära, in der scheinbar schon alle Geschichten erzählt sind, völlig überwertet, da sind sich Cinephile einig.
Für HBO’s „The Last of Us“ heißt das: Nicht der Plot ist der Aufhänger. Der Plot ist der Aufhänger, um die feinziselierten Emotionen und Reaktionen von Joel, Ellie & Co. zu beobachten. Es geht in superen Filmen und Serien nie wirklich darum, von A nach B zu kommen, das verstaubte Konzept der „Heldenreise“ gehört eingemottet. Die Reise ist das Ziel. Und was für eine Reise ist das, mit Pedro Pascal, Bella Ramsey und deren Charakteren.
Filme und Serien werfen dabei ganz nebenbei Fragen auf. Wie und warum verhalten diese Leute sich geradeso? Glaube ich ihnen? Wirken sie konstruiert? Wie würde ich mich verhalten? Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Sondern um Fragen, die die Welt bedeuten.
Publiziert am 16.03.2023