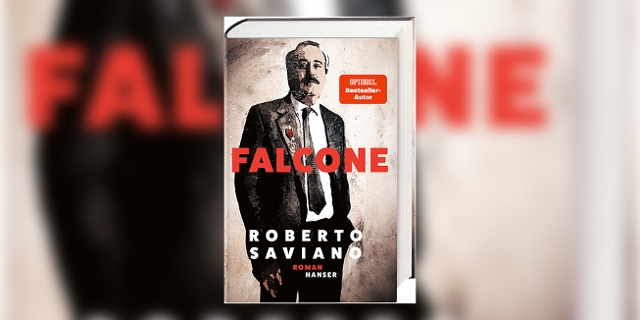„Ich bin für radikale Inklusion“
Von Maria Motter
„Alles inklusive - Aus dem Leben mit meiner behinderten Tochter“ von Mareice Kaiser ist 2016 bei S. Fischer erschienen.
Auf ihrem Blog Kaiserinnenreich findest du Interviews mit Eltern von Kindern mit Behinderungen und Mareice Kaisers Texte.
Mareice Kaiser nennt es „Chromosomenlotto“. Chromosomen bestimmen, mit welchen Merkmalen ein Mensch auf die Welt kommt. „Auf der ganzen Welt gibt es acht Milliarden Menschen, und das, was Greta hat, hat nur sie? Das ist ja ein Hauptgewinn. Greta ist also ein Jackpot, denke ich. Ein äußerst komplizierter Jackpot.“ Mareice Kaiser war die Mama eines Mädchens mit Behinderungen. War, weil Greta mit vier Jahren verstorben ist. Als Mareice Kaiser darüber twittert, folgt eine Welle an Beileidsbekundungen. So intensiv, so liebevoll und so direkt hatte die deutsche Journalistin in einem Blog über das Leben, über den Alltag mit ihrer behinderten Tochter geschrieben.
Mareice Kaiser lebt „in Berlin und im Internet“, sie könnte mit ihrem Musikwissen auch Konzertkritiken schreiben und so exakt wie ihr Pagenkopf geschnitten ist, bringt sie auf den Punkt, worüber viele nur herumdrucksen. Das Thema Behinderung ist belastet, es hat meist eine Schwere an sich, die einen Abstand halten lässt. Aber genau die Konfrontation wäre es, die viel Unbehagen auflösen kann - welch’ Allerweltsfeststellung! Es braucht offenbar Frauen wie Mareice Kaiser, damit man draufkommt, wie verschroben eigene Vorstellungen auch oft sind.
„Mir war es immer total wichtig, dass meine behinderte Tochter in erster Linie meine Tochter ist also ein Kind. Sie hat auch blonde Haare, blaue Augen und ein süßes Lächeln. Die Behinderung ist ein Merkmal“, sagt Mareice Kaiser. In dem Dorf, in dem sie selbst aufgewachsen ist, gab es einmal im Jahr eine Reise mit Behinderten. „So hieß das. Dann ist man in einen Freizeitpark gefahren zusammen mit zwanzig, dreißig, oft älteren Menschen mit Behinderungen. Es ist ein Zeichen von Exklusion, dass beispielsweise Menschen mit Behinderungen immer in Gruppen auftreten, weil sie in exklusiven Settings leben: in Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen, in Schulen gehen für Kinder mit Behinderung.“

div
Willensstarke Tochter
Als sie ihre Tochter auf die Welt bringt, überrascht das Baby seine Eltern: Greta ist mehrfach behindert. Die Ärzte müssen erst herausfinden, was Greta alles kann und was nicht. Wie beschreibt Mareice Kaiser ihre Tochter, damit man eine Vorstellung bekommen kann, wie sie war?
„Das erste Wort, das mir einfällt, ist willensstark. Das finde ich so spannend, weil sie ja nicht sprechen konnte und wir wissen nicht, wie viel sie hören konnte. Ansonsten bin ich natürlich die stolze Mama und finde, dass sie ein wunderschönes, kleines Mädchen war und auch sehr fröhlich und optimistisch, wie ich das auch von vielen anderen Kindern mit Behinderungen und chronischen Krankheiten kenne. Weil man ja ganz oft so von außen das anders wahrgenommen wird, also wenn Leute keinen Kontakt zu Behinderten haben, denken sie oft, oje, die haben es aber schwer. Meine Tochter hat mir nie suggeriert, dass sie es schwer hat. Klar: wenn sie mal krank war. Aber insgesamt war sie der positivste und entspannteste Mensch, den ich jemals kennenlernen konnte. Was auch ein Grund ist, warum ich immer diese Behinderten-feindlichen Sätze wie ‚Ich will nicht, dass mein Kind leidet‘ nicht verstehen kann. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie leidet, sondern dass sie supergern am Leben ist und das obwohl sie das Leben so ganz anders wahrgenommen hat als wir.“
Inklusion ist auch in Österreich noch nicht so lange der Fall. Meine Volksschule war die erste in der Steiermark, die Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung gemeinsam in einer Klasse aufgenommen hat. Nach den gemeinsamen vier Jahren hat sich in Graz kein einziges Gymnasium gefunden, dass diese Klasse komplett übernehmen wollte - außer einer Schule, der Klusemannstraße. Ein Einwand der Eltern anderer Schulen war, es könne nicht sein, dass dann ein behindertes Kind auch ein Zeugnis kriegt wie das eigene und am Ende vielleicht noch Matura mache.
Als ich Mareice das erzählt habe, stellt sie darauf eines klar: „Wir haben noch gar keine Inklusion. Wir leben noch gar nicht in einer inklusiven Gesellschaft - weder in Deutschland noch in Österreich. Sondern wir leben noch immer in einer exklusiven, in der Menschen mit Behinderung eher darum bitten müssen, Teil der Gesellschaft zu sein und teilhaben zu können. Mir ist wichtig, dass Inklusion ja nicht nur mit Menschen mit Behinderung zu tun hat. Inklusion und die inklusive Gesellschaft, so, wie es in der UN-Behindertenkonvention festgelegt ist, beinhaltet ja noch viel mehr, nämlich, dass niemand benachteiligt wird auch aufgrund der sexuellen Identität, der Hautfarbe, der sozialen Herkunft, des Geschlechts. Die UN-Behindertenkonvention ist ein guter Schritt, weil man damit etwas Rechtliches in die Hand bekommt und man sagen kann, doch, mein Kind hat das Recht, mit anderen Kindern in die Schule zu gehen. Übrigens auch wichtig anders herum: Wir können nur Inklusion in unserer Gesellschaft bekommen, wenn sich Menschen ohne Behinderung dafür einsetzen. Wenn Eltern nicht-behinderter Kinder sagen, ich will, dass mein Kind inklusiv aufwächst, ich will, dass es auf die Schule geht, auf die auch behinderte Kinder gehen, dann kann das funktionieren. Ich bin für radikale Inklusion. Ich finde, man kann und darf und sollte nicht warten.“
Für das Interview beschränken wir uns auf behinderte Menschen und ihre Familien. Wenn Mareice Kaiser jetzt eine Utopie gestalten könnte: Was würde sie sich wünschen und was fordern?
„In meinem Buch gibt es ja die Utopie einer inklusiven Gesellschaft. Die Überschrift, die über allem steht, ist, dass Menschen mit Behinderung keine BittstellerInnen sein müssen. Sondern dass das, was gebraucht wird für eine gesellschaftliche Teilhabe, gegeben wird und dass man sich dafür nicht bedanken muss. Niemand, der mit dem Rollstuhl unterwegs ist, muss sich dafür bedanken, dass es eine Rampe gibt. Die muss da sein. So. Ich möchte nicht, dass Eltern behinderter Kinder für einen Kindergartenplatz kämpfen müssen. Das muss einfach ganz selbstverständlich sein. Gleiche Rechte für alle. Ich bin der festen Überzeugung und das habe ich in meiner Arbeit als Journalistin auch gemerkt, dann funktionieren auch andere Sachen. Ich bin Verfechterin der radikalen Inklusion, weil ich gesehen habe, dass es funktioniert. Wenn ein Kind als Lernziel in einem Schuljahr hat, mit dem Löffel zu essen, und ein anderes Kind lernt binomische Formeln, ist es irgendwann für die selbstverständlich, dass da Steffi sitzt, der die ganze Zeit ein Speichelfaden aus dem Mund hängt und es ist auch klar, dass diese Steffi mit zu einer Klassenfahrt kommt. Wenn wir miteinander leben, gibt es ganz viele dieser Probleme nicht mehr. Dann gibt es vielleicht Neue, aber meine Erfahrung mit SchülerInnen von Inklusionsschulen ist: Die sind sehr kreativ in Problemlösungen!“
Wie kann man sich da zusammentun? Gibt es Bündnisse, die Angehörigen von Kindern mit Behinderungen in konkreten Situationen helfen?
„Das ist eine berechtigte Frage. Wenn du jetzt wie in meinem Fall als Elternteil von einem Kind mit Behinderung die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Widersprüche an die Krankenkasse zu schreiben oder um einen Kita-Platz zu kämpfen, dann hast du keine Kraft mehr, dich um andere Sachen zu kümmern, wie z.B. Bündnisse zu schließen, obwohl die total wichtig sind. Ich fand zudem Worte wie Selbsthilfegruppe ganz furchtbar und fand es immer schwierig, so festgelegt zu sein auf ‚Das ist jetzt die Mutter von dem behinderten Kind‘. Weil ich ja noch viel mehr bin. Mir hat es immer gut getan, wenn ich Eltern kennengelernt habe, die auch ein Kind mit Behinderung hatten, sich aber auch genauso für Musik interessiert haben, die ich gut finde, oder die gern ausgehen.“
Dass den Familien die Kapazitäten fehlen, sich auch noch zu organisieren, ist Kaisers Meinung nach auch gewollt von einem System, in dem strukturelle Diskriminierung herrscht. „Menschen mit Behinderung sind nicht gewollt von der Gesellschaft, vom System, wie auch immer man das nennt. Es geht sehr Richtung Leistungsgesellschaft und wer in dieser Leistungsgesellschaft nichts wert ist, der wird auch nicht unterstützt.“

div
Mareice Kaiser lebt zurzeit in Berlin. Zur Zeit des Nationalsozialismus stand die Adresse Tiergartenstraße Nummer 4 für das nationalsozialistische „Euthanasie“-Programm: für die systematische Ermordung behinderter Menschen, die geplant und organisiert wurde. Auch in Österreich gab es etliche Stationen, wo behinderte Menschen verfolgt und umgebracht wurden, mittlerweile arbeiten HistorikerInnen die Geschichten auf. Das ist gerade mal die Großelterngeneration her. Jetzt bestimmt sehr oft die Pränataldiagnostik auf sehr unsichtbare Weise, welche Babys auf die Welt kommen.
„Das sind Entscheidungen, die werdende Eltern, besonders werdende Mütter, treffen müssen, die man einfach nicht treffen kann. Für mich ist es schwer, etwas Allgemeingültiges dazu zu sagen“, sagt Mareice Kaiser. "Ich finde, das ist die riesengroße Frage: in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wer sortiert wen aus und weswegen? Wegen welcher Merkmale? Damit meine ich nicht, dass ich irgendeiner Frau das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch absprechen möchte. Auf gar keinen Fall. Frauen sollen selbst über ihren Körper entscheiden. Das steht nicht zur Debatte. Was zur Debatte stehen sollte sind die Gründe, weswegen sich Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden.
Wenn z.B. ein Grund ist, dass sich eine Frau das Leben mit einem behinderten Kind nicht vorstellen kann, weil sie noch nie Kontakt hatte mit einem Menschen mit Behinderung, dann finde ich das problematisch. Und die riesengroße Sorge besteht, das eigene Leben wäre dann vorbei. Diese Sorge kenne ich ja auch. Binnen drei Tagen – viel mehr Zeit hat man meist nicht – kann man sich da kein konkretes Bild machen. Deswegen ist meine Vorstellung und die ist vielleicht ein bisschen naiv: Je inklusiver unsere Gesellschaft wäre, desto weniger Schwangerschaftsabbrüche würde es geben wegen pränataldiagnostischer Diagnosen. Aktuell ist es ja so, dass neun von zehn Kindern, denen ein Down-Syndrom diagnostiziert wird, nicht zur Welt kommen.
Da entscheiden sich die Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch. Das ist eine krasse Zahl! Es ist tatsächlich so, dass Menschen mit Down-Syndrom aussterben, weil es einfach diese medizinischen Entwicklungen gibt. Wir Menschen wollen immer mehr wissen. So sind wir ja. Auch die Pränataldiagnostik ist nicht aufzuhalten. Die Frage aber, die wir uns stellen sollten, ist: Mit wieviel Wissen können wir eigentlich umgehen? Und bis wohin geht es mit dieser Selektion?
Im Moment ist es das Down-Syndrom, das wir aussortieren. Ist es in zwanzig Jahren die Veranlagung für Neurodermitis und in fünfzig Jahren die Veranlagung für eine starke Kurzsichtigkeit? Ich wünsche mir eine gesellschaftliche Debatte darüber, wo wir eigentlich eine Grenze ziehen wollen. Das Leben ist lebenswert und das nicht?"
Publiziert am 21.12.2017