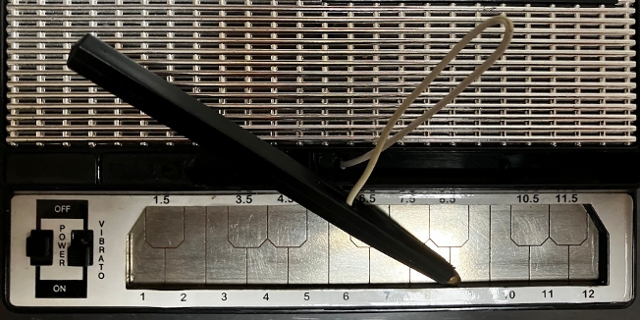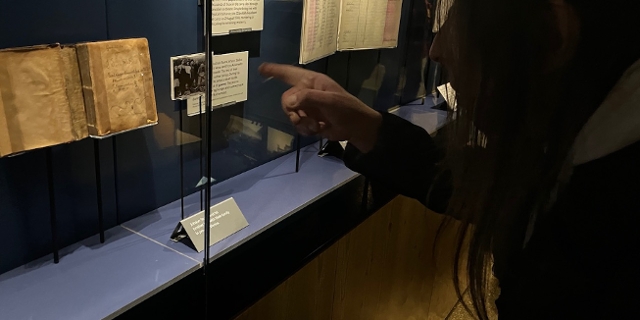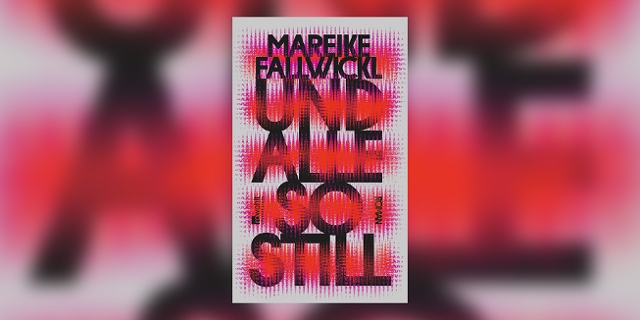Egghead Benedict und ich
Von Robert Rotifer
Vorgestern hab ich mich vor den Fernseher gesetzt. Auf Channel Four lief „The Uncivil War“, das TV-Drama über den Brexit mit Benedict Cumberbatch in der Rolle von Dominic Cummings, dem Strategen der 2016 siegreichen Leave-Kampagne. Es war nicht leicht anzusehen, schließlich weiß man schon vorher, dass die Bösen gewinnen werden, und noch dazu mit schlimmen Methoden, die teils Gegenstand rechtlicher Anfechtungen sind, im Drama also nur andeutungsweise dargestellt wurden.
Und selbst wenn die Sache „kritisch“ angelegt war, konnte Filmemacher James Graham doch offenbar nicht der Versuchung widerstehen, Cummings als eine Mischung aus Cumberbatchs Inkarnationen als Alan Turing und Sherlock Holmes bzw. als eine Art Tullius Destructivus darzustellen („Streit um Asterix“), der überall, wo er auftaucht, Zwietracht sät, einen Haufen imbeziler Politiker_innen vor sich hertreibt, und bei all seinen autistischen Zügen doch eine mysteriöse Gabe zum Verstehen der Launen der Massen besitzt.
Realität und Fiktion klaffen auseinander
Wir Menschen der britischen Gegenwart haben aber den echten Cummings sprechen gehört und gesehen und wissen, in echt wirkt der weder genial noch sonderlich aufregend. Außerdem tut es mir leid, hier einen Spoiler zu verschulden, aber wie ich neulich in meinem Blog erwähnt habe, war die Losung „Take back control“, die Cumberbatch/Cummings im Film in einer Reihe brillanter Geistesblitze gebiert, in Wahrheit schon 2014 wörtlich auf UKIP-Flugblättern zu lesen.
Das wiederum widerlegt auch ziemlich die andere These des Films, wonach nur Nigel Farage und seine rechte Parallelkampagne Leave.EU mit Fremdenfeindlichkeit gearbeitet hätten.
Tatsächlich hatte Cummings sich sein Vokabular direkt aus UKIPs Giftschrank geborgt. Was wir außerdem bezeichnenderweise nicht zu sehen bekamen: Dass, wie Ex-Aktivist_innen der Remain-Kampagne anekdotisch erzählen, Downing Street strikte Order ausgegeben hatte, Tory-Brexiteers wie Boris Johnson, Michael Gove und Priti Patel nicht persönlich anzugreifen, da man nach dem gewonnenen Referendum Parteifrieden unter den Konservativen sichern wollte. Ein Bedenken, von dem sich Johnson, Gove oder Patel ihrerseits jedoch nicht behindern ließen.
Die tollen Momente in „The Uncivil War“
Aber nicht, dass ich den Film nur schlecht machen wollte, da gab es schon ein paar tolle Momente, wie zum Beispiel eine fiktive Begegnung von David Camerons Kommunikationschef mit einer Fokusgruppe, in der sich alle möglichen demographischen Stereotypen versammeln: Der reaktionäre alte weiße Mann (Leave), der zornige weiße Arbeiterklassemann (Leave), die aufgeklärte urbane Frau aus der gebildeten zweiten Generation südasiatischer Herkunft (Remain), die sich von der britischen Innenpolitik entkoppelt fühlende Frau karibischer Herkunft (Remain oder gar nicht), der urbane junge Student mit „mixed-race background“ (Remain), sowie die verzweifelte weiße Frau, die einen Weinkrampf kriegt, weil ihr nie jemand zuhört. Wir ahnen, wie sie sich dafür rächen wird.
Natürlich kriegen sie sich dabei alle in die Haare, allerdings über das von der Kampagne projizierte Feindbild, nämlich die EU und die mit ihr verbundene „Migration“, und letztere ist dabei logischerweise nicht im Raum anwesend, weil nicht stimmberechtigt.

Robert Rotifer
Ich habe hier ja schon öfter über die spezielle britische Situation geschrieben, in der europäische Einwander_innen als Nicht-Brit_innen aus dem Konsens der (meist ohnehin nur geheuchelten) innerbritischen Inklusivität ausgenommen werden. So machte der Film auch keine Anstalten, die von der Brexit-Kampagne ausgelösten und legitimierten Aggressionen gegen sie zu thematisieren.
Nicht aus Bösartigkeit, schätze ich, sondern weil die Leute das meiner Erfahrung nach einfach nicht so wichtig nehmen. Die offizielle Linie ist schließlich, dass unsereiner eh nichts zu befürchten hat, und wer selbst nicht davon betroffen ist, glaubt das und hält sich mit den nervigen Details nicht auf.
Es gibt keine Sicherheiten
Tatsächlich gibt es zwar jede Menge Versicherungen seitens der Regierung (zuletzt von Theresa May persönlich in Polnisch an die knappe Million Pol_innen im Land), dass unser Bleiben erwünscht sei, aber wie dessen Bedingungen im Fall eines No Deal-Brexit aussehen, ist keineswegs so sicher.
It's irresponsible to scare EU nationals in the UK by hinting that their status might change after Brexit. No one's suggesting such a thing.
— Daniel Hannan (@DanielJHannan) 3. März 2016
Das einzige, das feststeht, ist vielmehr, dass unser Status selbst im Idealfall – entgegen früherer Versicherungen von Brexiteers wie Daniel Hannan (siehe obigen Tweet) – keineswegs so bleiben wird, wie er war. Wer seit 5 Jahren oder länger in Großbritannien lebt, soll einen „Settled Status“ erhalten, wer noch nicht solange da ist dagegen einen „Pre-Settled Status“, aber beides ist abhängig von einer Prüfung der Identität, durchgehender Anwesenheit (nicht so leicht ohne Meldepflicht) und des Leumunds, zuzüglich eines Unkostenbeitrags von 65 Pfund für die Bedienung einer automatisierten App, die schon im Oktober im Umlauf hätte sein sollen, aber jetzt angeblich für den Tag nach dem Brexit-Datum bereit sein wird (man wird sehen).
Für Leute, die diesen Status genießen, soll angeblich alles beim Alten bleiben, mit dem kleinen Unterschied, dass der Status bei fünf Jahren Abwesenheit wieder erlischt. Dann beginnt der Einwanderungsprozess von vorne, und künftig, da sind sich Labour und die Konservativen einig, solle es ein „ebenes Spielfeld“ für Einwander_innen aus der ganzen Welt geben. Uneinig ist man sich bloß über die Bedingungen dafür: Im lange aufgeschobenen White Paper des neuen Einwanderungsgesetzes geht die Regierung von einer Hürde eines Jahresgehalts von 30.000 Pfund, also rund 33.000 Euro aus, um länger als ein Jahr bleiben zu können.
Das ist um einige Tausender mehr, als etwa Krankenpfleger_innen oder Jungärzt_innen im staatlichen Gesundheitssystem NHS verdienen, dem es jetzt bereits an Hunderttausenden Arbeitskräften mangelt, aber bleiben wir einmal bei den eigenen Sorgen.
Das Home Office will also alle in Großbritannien wohnenden EU-Bürger_innen bis Ende März 2021 registrieren. Das bedeutet laut Rechnung der Pressure Group The 3 Million die Erledigung von 4500 Anträgen pro Tag. Das Problem der dafür nötigen App ist nicht nur, dass sie ausschließlich mit Android-Telefonen, nicht aber mit iPhones funktionieren wird (Apple-User_innen dürfen ihren Antrag wie bisher per Papier stellen).
In den Benützungsbedingungen der Beta-Version steht offenbar auch drin, dass das Home Office sich das Recht vorbehält, die erhobenen Daten mit Dritten zu teilen. Da diese Bedingung sich nicht ablehnen lässt, stellt sie nicht nur einen potenziellen Bruch der europäischen Datenschutzverordnungen, sondern auch der diesbezüglichen britischen Gesetze dar. Die öffentliche Diskussion darüber ist aber bisher völlig ausgeblieben.
Nun hat die österreichische Außenministerin gestern bei einer Pressekonferenz verkündet, dass es für Österreicher_innen in Großbritannien im Falle eines „harten Brexit“ (nehme an, damit ist „No Deal“ gemeint) ausnahmsweise die Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerschaft geben werde.
Das könnte man nun beruhigend finden, falls man die 1500 Euro für den britischen Naturalisierungsprozess bei der Hand hat, welcher allerdings mit einem ziemlich aufwendigen Citizenship Test verbunden ist, bei dem man sein Wissen für das assimilierte Leben so wichtiger Dinge wie etwa der Hauptcharaktere der Soap „Eastenders“ vorweisen muss.
Allerdings kann diese Einbürgerung von britischer Seite her nur beginnen, wer bereits über „settled status“ verfügt. Kafka lebt!
Darüber hinaus noch eines: Das Leben hier hat mir genau gezeigt, warum man zwei Staatsbürgerschaften haben wollen könnte. Zum Beispiel als Vater zweier in Großbritannien geborener britischer Kinder mit britischen Pässen aber Sohn österreichischer Eltern, der zu beiden Teilen dieser Familie den Kontakt zu halten gedenkt. Mit allen Eventualitäten, die einem das Leben so zwischen die Knie wirft.
Wenn ich das darf, warum dann nicht die Türk_innen in Österreich, die ähnlich gute Gründe haben, staatsbürgerlich mit einem Bein in beiden Ländern zu stehen? Ich weiß schon, im eigenen Interesse sollte ich das jetzt gar nicht zur Sprache bringen. Ich tu’s aber trotzdem.
Publiziert am 09.01.2019