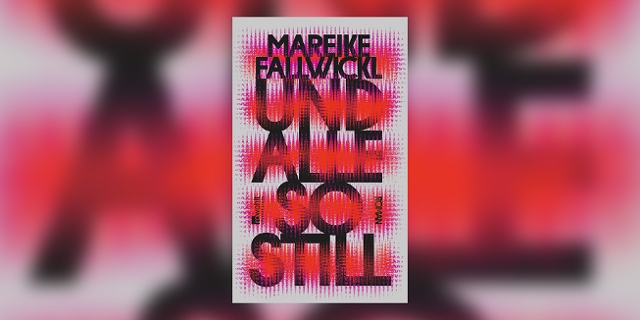„Weiß“: Bret Easton Ellis attackiert die Gegenwart
Von Christian Fuchs
Wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, seit Jahren den Bret Easton Ellis Podcast hört, dem werden die Themen dieses Buchs vertraut vorkommen. Der einstige Autor heftig umstrittener Bestsellerliteratur („American Psycho“) und beklemmender 80ies-Reflektionen („Unter Null“) hat sich längst zu einem bissigen Kulturkritiker gewandelt.
Das Ritual ist dabei immer das gleiche: Bevor Ellis seinen jeweiligen Interviewgast aus dem Showbusiness zu Wort kommen lässt, eröffnet er den Podcast mit einem schier endlosen Monolog. Er bespricht darin scharfzüngig aktuelle Filme oder Serien, demontiert Pop-Phänomene, seziert sarkastisch diverse Awards-Verleihungen. Oder er predigt wieder einmal sein zentrales Credo: Dass bei der Betrachtung von Kunst niemals der ideologische Gehalt im Vordergrund stehen darf, sondern immer nur die Ästhetik.
Wenn Teile der zeitgenössischen Kritik beispielsweise „Black Panther“ für die wichtigste Comicverfilmung halten, weil der Film das afroamerikanische Selbstbewusstsein stärkt und gleichzeitig „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ wegen angeblich rassistischer Untertöne ablehnen, dann haben sie, laut Bret Easton Ellis, das Kino grundsätzlich nicht verstanden. Weil, so der Kalifornier sinngemäß, eine mittelmäßige Marvel-Adaption nicht besser wird, wenn sie es gut meint - und eine sarkastische Annäherung an das Redneck-Amerika wiederum dringend dubios-düstere Zwischentöne braucht.
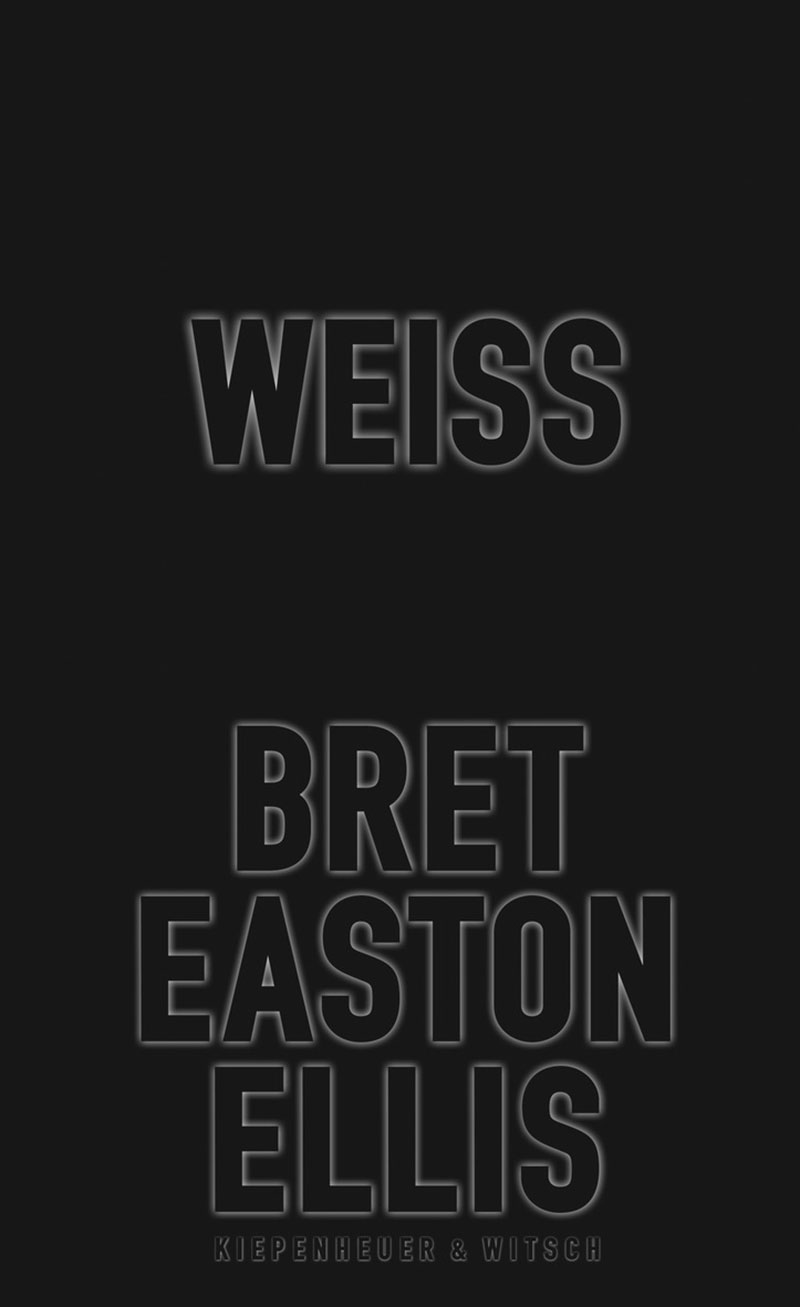
Kiepenheuer & Witsch
Wahre Meisterwerke, doziert Ellis, leben von ihrer umwerfenden Bildsprache, vom Sounddesign und schauspielerischen Nuancen, sie betören mit ihrem bloßen Style (er denkt dabei an Großkünstler wie Tarkowski und Antonioni als auch an blutige Splatterfilme), aber ganz selten mit ihrem schnöden Inhalt. In diesem Sinn hebt er die ästhetischen Qualitäten von beispielsweise Brian DePalmas sündigem Slasher-Thriller „Dressed To Kill“ hervor. Und polemisiert gegen den Opferkult im moralisierenden Hollywoodkino des Hier und Jetzt.
Häme über die „Generation Weichei“
Solche und noch entschieden kontroversere Diskussionen werden auch in „Weiß“ breit ausgewalzt, einer Essaysammlung, mit der Ellis seine lang andauernde Schreibkrise vorübergehend überwunden hat. Der 55-jährige Schriftsteller, selber liiert mit einem „sozialistischen Millennial“, wie er seinen jungen Freund nennt, macht sich über die Sensibilitäten der Generation Weichei lustig. Feiert die kulturelle Offenheit vergangener Epochen. Mokiert sich in den diffizilsten Stellen über die liberale Hysterie im Amerika der Trump-Gegenwart. Brillant formuliert (und solide übersetzt) schlägt Ellis bewusst über die Stränge. Setzt sich freiwillig in die Nesseln. Zerschlägt lustvoll Porzellan.
Als Kenner der Podcasts hört man beim Lesen förmlich die unverkennbare Stimme des Autors im Ohr. Die einzelnen Kapitel mit Titeln wie „Empire“, „Zweites Ich“ oder „Post-Sex“ werden von demselben Furor angetrieben wie seine berüchtigten Nonstop-Monologe. Man könnte sich Bret Easton Ellis dazu auch bildlich vorstellen, als alternden Intellektuellen in manspreading Pose, der sein potenzielles Gegenüber nur ganz spärlich zu Wort kommen lässt.
Auch wenn der literarische Dandy definitiv kein Reaktionär und Rechtsdenker ist, wie er oft klarstellt, lässt dieser offensive maskuline Gestus zumindest an Typen wie Michel Houellebecq oder Slavoj Žižek denken. An renitente Starautoren rechts und links des Meinungsspektrums, die in feministischen Kreisen gerade als Auslaufmodell gehandelt werden. Ellis, der ewige Agent Provocateur, weiß das natürlich - und wollte sein Buch ursprünglich im Gegenzug sogar „White Privileged Male“ nennen. Eine Idee, die er mittlerweile selber kindisch findet.
Sehnsucht nach dem Verbotenen
Warum sollte man „Weiß“ also lesen, wenn man sich den erwartungsgemäßen Spott gegen Diversitäts-Checklisten, Identitätspolitik und liberale Dogmen lieber ersparen will? Weil Bret Easton Ellis, als koksender Repräsentant kapitalistischer Dekadenz und gleichzeitig glühender Feind von corporate America, ein zorniges Unikat ist. Aus seiner speziellen Querkopf-Position heraus analysiert er bestechend die Mechanismen asozialer Netzwerke. Und erklärt auch schlüssig, wie sozial fortschrittliche Ideen von der Unterhaltungsindustrie aufgegriffen und vermarktet werden.

APA/GEORG HOCHMUTH
Die wirklich spannenden Passagen - und ja, da gibt es ziemlich viele - birgt das Buch aber, wenn Mr. Ellis die grantelnde Angriffsposition verlässt. In einem der herrlichsten Kapitel, gleich am Anfang, blickt er auf seine Adoleszenz im Kalifornien der 70er zurück. Bret Easton Ellis erzählt, wie weiße Mittelstandskinder damals oft völlig sich selbst überlassen waren, ohne besorgte Helikoptereltern, „die jeden Schritt ihrer Kinder auf Facebook dokumentieren und sie auf Instagram präsentieren und sie in sicheren Zonen einhegen und nur Positives zulassen, während sie die Kleinen offenbar vor allem behüten wollen.“
Das Kapitel macht deutlich, dass auf dieser infantilen Sehnsucht nach dem Verbotenen das ganze Fundament der westlichen Popkultur beruht, vom Rock’n’Roll bis zum Gangsta-Hip-Hop, von wilden Exploitationmovies, denen Tarantino seine Karriere verdankt, bis zum Serienboom voller Sex, Gewalt und perfider Charaktere (Hallo, „Game of Thrones“). Wie Ellis seine aufbrausende pubertäre Liebe für das Horrorkino beschreibt, inklusive heimlichen Jugendverbot-Vorstellungen, evoziert beim Lesen Gänsehaut. Und könnte als Manifest beim Wiener slashfestival vorgetragen werden.
Loblied auf die menschliche Ambivalenz
Während das Buch an vielen anderen Stellen mit seinem politischen Provokationsrausch müde macht, kristallisiert sich aus dieser Freude am künstlerischen Tabubruch die zwingendste Schlüsselthese von „Weiß“ heraus. Bret Easton Ellis fragt sich etwa, ob der Zwang aktueller Drehbuchautoren feministische, antirassistische und generell gesellschaftskritische Komponenten ständig mitzudenken, automatisch bessere Filme hervorbringt. Oder ob die Zensurschere im Kopf nicht das Gegenteil bewirkt - und wütende, ungezügelte, obsessive Werke in naher Zukunft unmöglich werden, egal ob im Kommerz- oder Kunstsektor.
Bret Easton Ellis versteckt sich in „Weiß“ jedenfalls nicht hinter einer literarischen Figur wie in seinen berüchtigten Romanen früher. Er verzichtet auch auf Image-Spiele, wie sie sein Kollege Houellebecq betreibt. Er deklariert sich: als Verfechter bedingungsloser Meinungs- und Kunstfreiheit, vor allem aber als Fürsprecher der Ambivalenz. In seinen besten Momenten ist dieses Buch ein Loblied auf das Uneindeutige und Zwiespältige, auf die menschliche Existenz in all ihrer Widersprüchlichkeit, Gestörtheit und Schönheit.
Publiziert am 26.04.2019