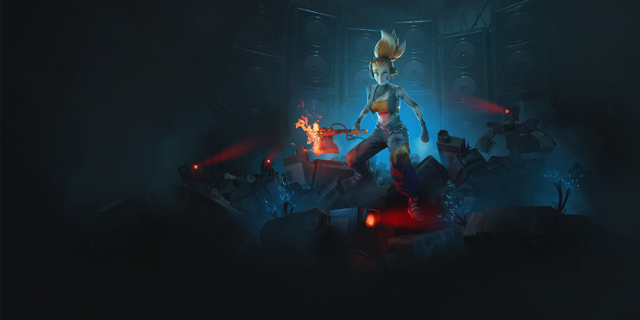Matty, heal me: The 1975 in der Metastadt Wien
Von Lisa Schneider
Es ist kein Festival, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Immerhin bekommt man nicht jeden Tag einen Konzertabend geliefert, an dem es fast sechs Stunden - geliefert von drei Acts - durchgehend Musik zu genießen gilt. Es ist ja aber auch ein großer Feiertag: Die Metastadt, Wiens neue Open-Air-Live-Location im 22. Bezirk, will eingeweiht werden. Platz wäre hier für 6000 Besucher*innen – ganz voll ist es gestern Abend nicht geworden. Angenehm für alle, die da waren.
Die Besucher*innen sind vor allem eins: sehr jung und sehr dedicated. Einige von ihnen haben tatsächlich von Sonntag auf Montag vor den Toren der Metastadt übernachtet – um bei ihrem Helden, dem Sänger von The 1975, Matty Healy, in der ersten Reihe zu stehen. Diese Mühe wäre vielleicht nicht notwendig gewesen: Mit ein bisschen Kampfgeist hat man es auch zu späterer Stunde noch nach ganz vorne geschafft.
The Japanese House
The Japanese House war ja immer ein kleines Mysterium. Die englische Musikerin Amber Bain hat unter diesem Namen schon vier EPs veröffentlicht, und immer war noch nicht klar, wie sie eigentlich aussieht. Gender – und Genregrenzen überspringen, das war der Plan. Waren besagte vier EPs noch eher im Genre Elektrofolk/Indietronica angesiedelt, umreißt ihr im heurigen Frühjahr veröffentlichtes Album „Good At Falling“, wie sich Synthie-Dreampop im Jahr 2019 anhören muss.
Deftiger Autotune-Einsatz, mal brodelnd, dann wieder gedämpft. Als hätten sich diesmal Justin Vernon und Imogen Heap in der schön-romantischen Waldhütte eingeschlossen und ihre Tagebücher ausgepackt: Es ist ein Album über die verlorene Liebe geworden.
Auf der Bühne also lüftet sie schließlich spätestens das Geheimnis – und gerade Bühnen hat Amber Bain in den letzten Monaten gut kennengelernt. Eigene, kleine Clubshows, aber vor allem ihre erste große Tour mit The 1975 hat sie gespielt. Zu The 1975 hat Amber Bain eine enge Beziehung: immerhin wird schon ganz am Anfang ihrer Karriere gemunkelt, The Japanese House sei eigentlich ein Nebenprojekt von Frontmann Matty Healy. Das ist nicht so weit hergeholt. Sie ist beim selben Label - Dirty Hit - untergekommen. Und George Daniel, Drummer von The 1975, hat ihr erstes Album mitproduziert.
Es ist ein schöner Start in den Montagabend – auch, wenn Bass und Drums für den richtig guten Sound zwischen den jahrhundertealten Backsteinziegeln zu laut und deftig aufgedreht waren: The Japanese House führt ihr Publikum durch die verschiedenen Stadien einer Beziehung, vom ersten Kribbeln in den Fingerspitzen zum großen Hoch – und schließlich zum Eingeständnis, dass es eben so nicht passt: „I needed someone to depend upon / I was a loner, was emotional“ singt sie auf „Lilo“. Sie schenkt sich aber auch selbst nichts: „Everybody hates me now“.
Die Beziehung, die The Japanese House hier – wie immer auf Tour verstärkt durch volle Bandbesetzung - visuell und musikalisch auf die Bühne holt, hat im realen Leben nicht funktioniert. Man darf sich aber ein Konzert immer auch als eine Art Traumwelt vorstellen – wo Gefühle, die guten und die schlechten – oft besser aufgehoben sind als in der Realität.
Two Door Cinema Club
Es ist ein kleiner British-Irish Allstar-Abend gestern in der Wiener Metastadt, nur englische Acts stehen auf der Bühne, man kennt sich – man kennt sich schon lange. Two Door Cinema Club ist die Band, die etwa drei Jahre vor The 1975, 2010, ihren Durchbruch feiert. Dass sie jetzt vor The 1975 auf der Bühne stehen, ist ein kleines, an anderer Stelle zu besprechendes Drama. Früher war es einmal umgekehrt: Da haben die anderen die einen supported. The music biz is quick and dirty.
Für das Publikum ist die Platzierung von Two Door Cinema Club an diesem Abend nur von Vorteil. Das ist die Ernte fürs viele Spielen, fürs viele Touren: Sie locken ihre Die-Hard-Fans in die Metastadt, und sie spielen natürlich auch die Hits. Und wieviele Hits diese Band in den letzten einenhalb Jahrzehnten geschrieben hat, wird einem erst bewusst, wenn man dort vor der Bühne steht: „Undercover Martyn“. „I Can Talk“. „Something Good Can Work“. Songs, die Menschen, die vor fünfzehn Jahren das damals noch klingende Genre „Indie“ für sich entdeckt haben, im Schlaf mitsingen können.
Gute, hibbelige Songs für den noch nicht dunklen Abend, der auch schön vom doch eher ruhigen Set von The Japanese House hinüberführt zum Upbeat. Einige Songs des neuen Albums, etwa auch „Diary“, erinnern an die Anfangszeiten der Band, damals noch bei der französischen Indietronica-Hochburg Kitsuné veröffentlicht. Two Door Cinema Club lehnen sich mit ihren neuen Songs nicht aus dem Fenster, zumindest aber stecken sie die eigenen Grenzen weiter aus: Funk- und Discoklänge, vor allem wabernder, elegant-geschmeidiger Synthiepop scheppert über und mit ihrem früheren, doch sehr straighten Gitarrenpop. Die Bühnenoutfits und –deko sind über die Jahre schräger und bunter geworden. Alles ist rot – außer Frontmann Alex Trimble. Der steht im blauen Anzug, garniert mit senfgelbem Shirt, dort oben.
„False Alarm“ nennen Two Door Cinema Club ihr neues Album und beziehen sich damit auf die müßigen Töne, die uns unsere Smartphones, Tablets, Laptops den ganzen Tag entgegenpiepen. Immer ist alles wichtig. Oder nicht? Das aktuelle Album von The 1975 ist thematisch im selben Spektrum angesiedelt: Es heißt „A Brief Inquiry Into Online Relationships“. Ja, die Handys sind auch am gestrigen Abend gezückt und hungrig. Instagram wartet.
The 1975
The 1975 sind noch immer eine Band der Stunde. Das waren sie mit dem Release ihres erwähnten, dritten Albums Ende November letzten Jahres. Und das waren sie damals auch deshalb, weil sie ähnlich wie etwa Foals gleich die geplante Veröffentlichung zweier Alben innerhalb eines Jahres angekündigt haben.
Bis jetzt heißt es aber noch: Warten. „Notes On A Conditional Form“, das vierte Album von The 1975, sollte eigentlich schon im Mai 2019 erscheinen, der Releasetermin wurde aber verschoben. Traut man diversen Gerüchten, könnte es Mitte August soweit sein. Das ist alles natürlich kein Zufall.
Gute Songs zu schreiben, eventuell auch gut spielen oder singen zu können, sind längst nicht mehr (nur) die Dinge, die zählen, um als Band erfolgreich zu sein. Oder zu bleiben. Marketing will gelernt sein. Die Übersicht darüber zu behalten, wie sich die Hörgewohnheiten der Fans ändern. Auch deshalb funktioniert die Musik von The 1975 wie eine gut kuratierte Playlist. Das ist nicht nur spannend und abwechslungsreich für die Band, das ist vor allem bewusst und vorausschauend. Sie selbst mögen My Bloody Valentine, aber auch Tears For Fears. Ihre Fans mögen – neben The 1975 – womöglich Tyler, The Creator und Vampire Weekend. In den Songs von The 1975 findet man Verweise auf so gut wie alles, was gut ist.
Ähnlich wie The 1975 arbeiten aktuell eigentlich nur Twenty One Pilots. Die Band, deren 2015 veröffentlichtes Album „Blurryface“ es erst vor kurzem zum meistgestreamten Album überhaupt geschafft hat. Die das Wort Genre-Crossover in ganz neuer Weise definiert hat: Hier trifft Rock auf Hiphop, Pop auf Elektronik. Auch live switchen The 1975 wie aktuell niemand sonst zwischen diskoesken, Justin Bieber nicht unähnlichen Nummern und ihrer ganz eigenen Interpretation von Prince’ „Kiss“: sie heißt „Love Me“. Matty Healy weiß, dass er borgt, dass alle, die nach ihm kommen, borgen müssen. Die Popgeschichte ist eine Geschichte der Wiederholung, und auch er versucht sich am Mick Jagger’schen Hüftschwung. Vielleicht liegt darin die richtig große Kunst: sich einzugestehen, dass man Dinge nur mehr reproduzieren kann.
Noch dazu ist The 1975 eine Band, die man live gesehen haben muss, um richtiger Fan zu werden. Nur live – inklusive der zwei großartigen Backgroundtänzerinnen und den fluiden Dancemoves, die Matty Healy manchmal sacht mitmacht, erzählt die Band ihre vollständige Auffassung von Pop. Sound- und Genreclashes, sofern es da aktuell überhaupt noch Grenzen einzureißen gibt. Der Highschool-Ball, den wir alle gern gehabt hätten, und den sie jetzt musikalisch vor uns ausbreiten.

Franz Reiterer
Es ist also alles da, was eine Band einem breiten Publikum bieten muss. Vor allem ist – und das ist nicht so schrecklich, wie es klingt - für jeden und jede etwas dabei. Ein Erfolgsrezept, das, wenn gut gemacht, nach logischer Konsequenz funktionieren muss. Und das, folgt man Matty Healy im FM4-Interview, so eigentlich nicht geplant war: „I suppose we have been quite polarizing. But I want a quite strict door policy on my band, I don’t want everyone getting it, cause then it’s not real, you know.“ Solche Sätze zu formulieren, fällt sicher leichter, wenn man vor ausverkauften Hallen spielt.
Vielen Bands wird nachgesagt, sie wären abwechslungsreich, erfänden sich von Song zu Song neu. The 1975 tun das tatsächlich. Man muss nur zwischen dem R’n’B-lastigen, sehr smoothen Überhit (alleine auf Spotify über 250 Millionen Streams) „Somebody Else“, dem geschmeidigen, klugen Popsong „Love It If We Made It“, der Akustik-Gitarrenballade „Mistake“ oder der Spoken-Word-Nummer „The Man Who Married A Roboter“ hin- und herzappen.
Schön auch, dass gerade dieser letztgenannte Song den Weg zu etwas ebnet, was man durchaus als Matty Healys gesundes Selbstbewusstsein bezeichnen darf: Das aktuelle The 1975-Album, so in der Vorankündigung, sei nichts weniger als ihr eigenes „OK Computer“. Damals, als Alben noch die Welt bestimmten oder zumindest lange Teenagerjahre geprägt und meistens erträglich gemacht haben, waren Radiohead die großen Helden des gemeinsamen Außenseitertums. Matty Healy und seine Band schreiben Musik in einer Zeit – in unserer Zeit - die eben zu einem Großteil online passiert. Prophetisch gesehen also ja: der Impact ihres Albums könnte dem von Radiohead gar nicht so unähnlich sein.
Virtuelle Herzen verteilen, ziemlich viel Blödsinn verzapfen. Dass das Internet als Sozialstudienplatz eine ergötzliche Plattform bietet, haben natürlich nicht nur The 1975 erkannt. Anders als andere aber haben sie eine Reichweite, vor allem auch, was junge Fans angeht, die von Anfang an mit Social Media und allen zugehörigen Phänomenen aufgewachsen sind. Das macht The 1975 nicht zu Predigern. Aber sie rufen im Online-Wahnsinn, den wir heute zu großen Teilen unser Leben nennen müssen, zum guten, alten Miteinander auf. Vor allem auch zur direkten Form der Konversation.
The 1975 werfen mit ihrem aktuellen, dritten Album nicht nur eine große Frage auf (Wie wird unser Online-Verhalten unsere Gesellschaft verändern?), sie beantworten gleichzeitig eine andere: Werden Bands, die keine Statements setzen, über kurz oder lang weiterhin ernst genommen werden? Nein. Imagine Dragons, ein Vergleich nach Größenordnung, können davon ein „Whoa, Whoa, Whoa, radioactive“-Lied singen.
Diskutiere mit!
Publiziert am 09.07.2019