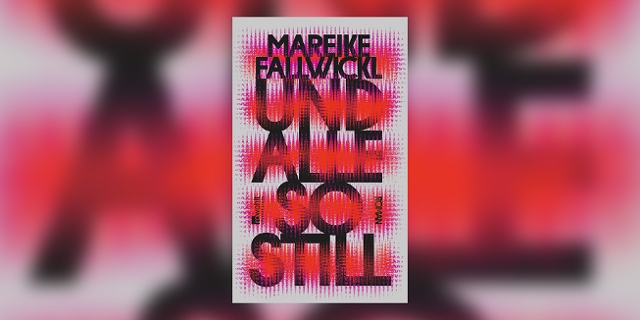Ingrid Brodnig über Social Media und Netzpolitik im Wahlkampf
Interview: Christoph „Burstup“ Weiss
In Ihrem neuen Buch geht es um die großen Social-Media-Konzerne sowie um die dort stattfindende Datensammlung und Wahlbeeinflussung. Gibt es im aktuellen Wahlkampf in Österreich Ihrer Meinung nach Parteien, die Social Media und deren Algorithmen besonders effektiv benützen? Was fällt besonders auf?
Ingrid Brodnig: Wir sehen, dass viel Geld in den digitalen Wahlkampf gepumpt wird. Seit März veröffentlicht Facebook, wie viel Parteien für Werbung ausgeben. Seit März waren das in Österreich circa 2,5 Millionen Euro. Meiner Schätzung nach entfallen davon etwa 1 Million Euro für Werbung auf Facebook. Die SPÖ wirbt derzeit dort am meisten.
Was die Algorithmen betrifft, muss ich sagen: Der Wahlkampf ist diesmal fast schon ein bisschen langweilig, denn die FPÖ, die auf Facebook immer recht laut gepoltert hat, hat große Probleme rund um Strache und seinen Facebook-Account. HC Strache war ja die wichtigste Facebook-Site der FPÖ.
Zum Vergleich: Strache hat auf Facebook ein paar Freunde verloren, aber immer noch knapp 800.000 Fans, Sebastian Kurz ist ungefähr gleichauf mit etwas mehr als 800.000. Wie lässt sich die Popularität von Straches Facebook-Site trotz des Ibiza-Skandals erklären?
Ingrid Brodnig: Man kann es sogar noch ärger sagen: Strache hat mehr Interaktion. Pro Post hat er mehr Likes, mehr Kommentare und mehr Shares als Kurz. Er hat mehr Interaktion als jeder Politiker, der zur Wahl antritt. Diese Site funktioniert irre gut. Er hat sich eine Community aufgebaut, die auf die Themen der FPÖ – Migration, Asyl etc. – total aufsteigt. Da halten die anderen Parteien nicht mit, und auch die FPÖ hat keinen anderen vergleichbaren Kanal. Es zeigt sich wieder: Populisten haben es leichter im Netz, weil sie wütend machende Themen haben.
Wenn es um die große Macht der Social-Media-Konzerne geht: Welchen Parteien oder Politiker*innen ist zuzutrauen, dass sie dieser Übermacht am ehesten etwas entgegensetzen und gesetzliche Maßnahmen ergreifen, die wirklich wirksam sind?
Ingrid Brodnig: Ich finde derzeit faszinierend, wie wenig dieses Thema im Wahlkampf vorkommt. Es ist fast schon schockierend. Es geht um einige der wichtigsten Fragestellungen unserer Zeit. Zum Beispiel: Wer passt auf, dass Facebook seine Macht fair einsetzt? Wer passt auf, dass Amazon kleinere Mitbewerber fair behandelt? In Österreich wird darüber überraschend wenig geredet. Wir hatten in der letzten Regierungsperiode das Thema Hass im Netz. Die türkis-blaue Regierung hat das „digitale Vermummungsverbot“ als Maßnahme dagegen ins Spiel gebracht. Aber jetzt im Wahlkampf sind solche Themen sehr selten präsent.
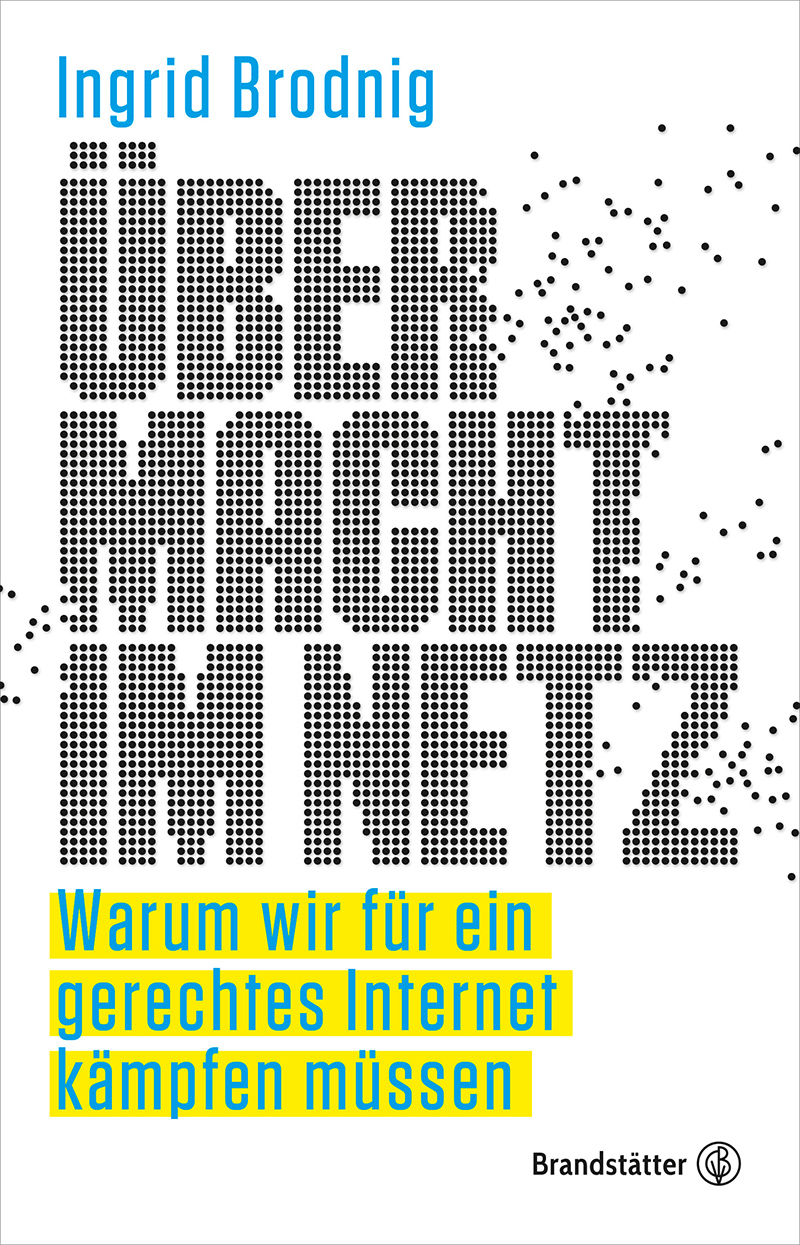
Brandstätter Verlag
Ingrid Brodnigs aktuelles Buch „Übermacht im Netz - Warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen“ ist erschienen im Brandstätter Verlag.
Das sogenannte „digitale Vermummungsverbot“ - also die Klarnamenpflicht beim Posten in Internetforen - kommt nächstes Jahr, das Gesetz ist bereits beschlossen. Schon seit September müssen wir Prepaid-Wertkarten für Mobiltelefone mit Ausweis registrieren. ÖVP und FPÖ war beides sehr wichtig. Wie sehen sie die Tendenz, die Anonymität im Internet als etwas Gefährliches darzustellen und zu beschränken?
Ingrid Brodnig: Ich bin da skeptisch. Erstens ist nicht jeder, der anonym ist, ein Hassposter. Manchen Menschen ist Anonymität wichtig, weil sie Angst haben – zum Beispiel feministischen Userinnen, die Pseudonyme nutzen, weil sie Angst haben, dass sonst Antifeministen vor ihrer Tür stehen. Viele strafrechtlich relevante Postings hingegen stehen mit echten Namen im Internet, vor allem auf Facebook.
Es ist also zu simpel zu sagen, wir schränken die Anonymität ein und lösen damit das Problem. Die vorvorige Regierung, also Rot-Schwarz, hat versprochen, eigene Staatsanwälte aufzubauen gegen Hasskriminalität im Internet. Dafür ist nie das Geld gekommen. Warum gibt man nicht der Justiz mehr Geld und Personal, damit sie solche Fälle ernsthaft verfolgt? Es ist ein komplexes Thema, warum reden wir darüber im Wahlkampf nicht mehr?
Ein Thema, das im Wahlkampf ebenfalls kaum vorkommt, ist das der Überwachung. Im bereits beschlossenen Sicherheitspaket sind viele neue Überwachungsmaßnahmen enthalten, zum Beispiel der Bundestrojaner - also staatliche Computerviren, behördliche Schadsoftware auf unseren Computern und Smartphones. Das Sicherheitspaket und die darin vorgesehenen Überwachungsmethoden spielen aber im Wahlkampf ebenfalls keine Rolle. Warum ist das so?
Ingrid Brodnig: Ich glaube, dass andere Themen bei den Parteien eher wahrgenommen werden als „Goalgetter“. Die Grünen zum Beispiel treten oft sehr überwachungskritisch auf. Ihr Wahlkampf aber ist sehr stark auf das Thema Klima fokussiert.
Das Thema Klima scheint jetzt gerade allen Parteien wichtig zu sein - weil deshalb sehr viele junge Menschen auf die Straße gehen. Social Media helfen hier, weil sie die Vernetzung dieser Menschen weltweit ermöglichen. Also eine positive Veränderung. Sind wir manchmal zu pessimistisch, wenn es um die Einordnung der Rolle der Internetkonzerne geht?
Ingrid Brodnig: Das ist ein guter Punkt. Es kann gut sein, dass ohne soziale Medien das Klimathema nicht so präsent wäre, weil die Mobilisierung von Gleichdenkenden – zum Beispiel von Jugendlichen, die der Klimawandel beunruhigt – über diese Kanäle leichter geht. Das sind ja oft Einheiten, die überhaupt kein Geld haben, um sich anders zu organisieren.
Ich glaube aber, das ist kein Verdienst der Unternehmen, sondern ein Verdienst der Aktivisten. Wir sehen einen Wandel im politischen Denken. Jetzt reden alle Parteien darüber, aber es stellt sich die Frage, wie viel sie in der Vergangenheit getan haben. Junge Menschen sind sehr politisiert. Eine Partei, die in den nächsten Jahren noch punkten will, muss das Klimathema in Zukunft noch viel ernster nehmen als jetzt. Parteien richten sich aber noch nach älteren Wählern aus.
Ein zweites Thema, das junge Menschen heuer sehr emotionalisiert hat, war die Urheberrechtsreform, und hier besonders die Upload-Filter. Es geht eigentlich um die Frage, ob die Betreiber*innen von Plattformen verantwortlich sein sollen für die Inhalte, die User*innen hochladen. Wenn die Plattformen verantwortlich sind, dann müssen sie kontrollieren, also filtern. Auch die Upload-Filter haben vor der Einführung viele junge Menschen auf die Straße getrieben - allerdings ohne Erfolg, denn das neue Urheberrecht wurde trotzdem beschlossen. Ist diese Debatte, die noch vor kurzem so viele Menschen bewegt hat, jetzt nur noch ein Randthema bzw. schon komplett in Vergessenheit geraten?
Ingrid Brodnig: Man muss generell sagen: In der österreichischen Innenpolitik war das Thema Upload-Filter nie so präsent, wie es hätte sein sollen. In Deutschland wurde das von den klassischen Medien sehr stark wahrgenommen. Ich glaube, dass hier die Politik und auch der Journalismus Gefahr läuft, an den Themen vorbeizureden, die Jugendliche und junge Erwachsene beschäftigen. Auf Youtube kam man an dem Thema nicht vorbei. Was hier passiert ist, ist eine Politisierung der Jugend. Die Proteste rund um die Upload-Filter und rund um die Klimakrise haben Menschen auf die Straße gebracht, die für etwas brennen.
Wenn Parteien clever sind, versuchen sie jetzt, dort anzudocken und so neue Wähler zu ergattern. Natürlich können sie sagen: Wenn wir viele Pensionisten haben, die uns wählen, dann läuft das noch zehn bis zwanzig Jahre gut. Aber irgendwann werden diese jungen Menschen erwachsen werden und selbst Kinder haben. Es wird viel zu wenig über digitale Themen geredet, denn natürlich ist es ein Problem, wenn das Urheberrecht so über Grundrechte gestellt wird, dass man Sorge haben muss, dass vielleicht zu viel aus dem Netz entfernt wird.
Ingrid Brodnig, vielen Dank für das Gespräch.
Publiziert am 25.09.2019