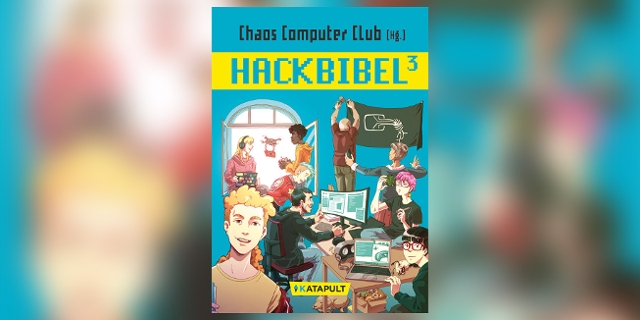Wann, wenn nicht jetzt: 60 Stunden lang „The Wire“ nachholen
Von Martin Blumenau
1
Wahre Geschichte, ich schwöre: Als ich dazustoße zum nachbarschaftlichen österlichen Sicherheits-Abstands-Kaffeetrinken im Gemeinschaftsgarten jenseits der Gstettn, geht es gerade um Serien. Und der Rasmus sagt, dass er „Treme“, die wunderbare Serie über das im Wiederaufbau begriffene New Orleans nicht zu Ende sehen mochte, weil er direkt davor „The Wire“ gesehen hatte und seine Erwartungen an Serien da einfach zu hoch waren. Nichts reicht an „The Wire“ ran, höre ich mich sagen und ich bin überrascht, wie viele in der Runde nicken.
2
„The Wire“ ist nicht nur die Lieblingsserie von Stephen King oder Obama (siehe Video unter dem Text), auch die Bewohner von Baltimore, Maryland, USA, wo die 5 Staffeln spielen, waren bei der Erstausstrahlung im Serien-Fieber, auch weil die dort erzählten Geschichten so wahr sind, dass es weh tut. „The Wire“ beginnt als Räuber & Gendarm-, also als Drogendealer-versus-Polizei-Story im neoliberalen Post-9-11-Zeitalter, als begonnen wurde, alles zugunsten einer neuen Sicherheits-Doktrin und einem nicht gewinnbaren War on Drugs totzusparen: Schule, Verwaltung, Fürsorge, auch die Polizei selbst.
3
„The Wire“ ist die Serie aller Serien, sie ist die „Ilias“ unserer Tage oder auch Dantes „Inferno“. Was im klassischen Gut gegen Böse beginnt, endet in subtiler Ausdifferenzierung und der treffsicheren Beschreibung unserer modernen Welt: Alles hängt mit allem zusammen, jedes Handeln hat Wirkung. Nichts wird beschönigt, nichts wird übertrieben, wir leiden und bangen mit gut 50 zentralen Charaktere aus dem Alltag von Baltimore, Polizistinnen und Gangster, Politiker und Journalistinnen, Anwältinnen und Lehrer, Hustler und Junkies. Und niemand ist nach diesen 60 Folgen mehr derselbe wie vorher: Nicht die (überlebenden) Figuren und auch nicht wir Zuschauer*innen.
4
Showrunner David Simon, früher Polizeireporter, dann Autor, spannt über fünf Staffeln einen gewaltigen epischen Bogen voll geschickter, immer glaubwürdiger Dramaturgie, der vom ständig strauchelnden Junkie bis hin zum immer windiger werdenden Bürgermeister-Kandidaten, von der sich selber spielenden Gang-Enforcerin bis hin zur mythischen Robin Hood-Figur reicht, der in den relevanten Settings einer gebeutelten modernen urbanen Community spielt, in den veränderten Arbeitswelten, egal ob im Hafen oder in den Medien, auf der Straße, in der Gemeinde-Politik oder in der Schule.
5
Überhaupt, die Schule, das Überthema der 4. Staffel, der emotionale Höhepunkt der Serie. Mich hat keine Serie, kein Film, kein Buch, kein Song, kein Bild, nichts, was man im allgemeinen als Kunstwerk bezeichnet, jemals derart zerrüttet zurückgelassen. Ich habe danach trotzdem oder vielleicht gerade deswegen Kinder bekommen.

HBO
Wie Simon und sein Cast aus zumeist Amateuren und Newcomern es trotzdem schaffen, die grundsätzlich fatalistische Stimmung im Kampf mit dem kaputtmachenden System wieder in Richtung von kreativen Lösungen aufzubrechen, ist die Basis des Überlebens einzelner Protagonisten.
6
Und das sind allenthalben eindrückliche Figuren, egal ob sie scheitern oder sich durchwurschteln. Ihnen gemeinsam ist, dass sie nicht als Schwarz-Weiß-Charaktere missbraucht werden, alle ihre Graubereiche haben, sogar der korrupte Senator in Annapolis oder Stringer Bell, der Vize-Chef der Drogendealer-Gang, der die kapitalistische Ökonomie im Volkshochschul-Kurs lernt und dann praktisch anwendet. Stringer, diese zwischen Abgebrühtheit, Coolness und Zurückhaltung pendelnde Fassade eines Menschen unter permanenter Anspannung, ist die wahre Hauptfigur der Serie und nie davor und nie nachher war der grandiose Idris Elba besser, auch nicht als Luther.
7
Es die knappe, authentische Sprache der Autoren, von Weltklasse-Schriftsteller wie George Pelecanos oder Richard Price, die den Figuren Würde und Klarheit verleiht, sie Sätze sagen lässt, die wie Macheten durchs verlogene Dickicht unseres Alltags schneiden.
Es ist die Sprache von „The Wire“, die in mir noch immer nachhallt. Ich sage true that!, ich frage you feel me?. Ich sage po-po zur Polizei, snitch zum Spitzel und stash zur Schoko-Lade.
Die Sprache ist aber auch ein mögliches Hindernis: auf Deutsch geht „The Wire“ gar nicht, die Slang-Übersetzungen sind nett gemeint, aber lachhaft, im Original aber geht’s aber auch nicht: zu schnell, zu dicht, zu sprechintensiv. Die Lösung: englische Untertitel, also hören und gleichzeitig lesen und ja, manchmal zurückfahren und etwas zweimal anschauen oder -hören, um auch den Subtext zu verstehen, der wie ein Nebel aus Tränen oder Morgentau die meisten Figuren umflort.
8
In „The Wire“ geht es geht um unser Zusammenleben, sagt David Simon, und darum wie die Institutionen sich darauf auswirken. Passt also gerade verdammt gut in die Zeit.
Zurück zur wahren Geschichte aus dem österlichen Gemeinschaftsgarten: Als Mani sagt, er habe damals nach ein paar Folgen aufgegeben, würde es aber gerne wieder probieren, sagt meine Frau: Ich hol dir gleich die DVD-Box. Wann, wenn nicht jetzt.
Publiziert am 15.04.2020