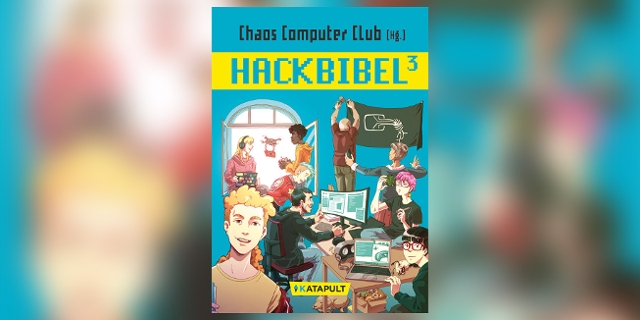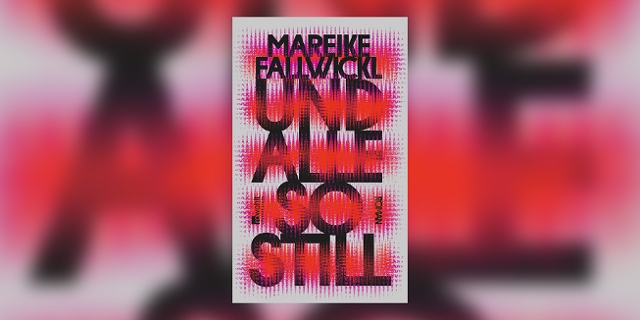Die große Depressionsmaschine im Kopf
Von Maria Motter
Es ist ein hartes, doch erkenntnisreiches Buch: Benjamin Maack hat eigentlich nicht über Depression geschrieben, sondern vielmehr aus der Depression heraus. Der deutsche Autor erzählt in „Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein“ innig und sich selbst gegenüber doch schonungslos, was los ist, wenn die „große Depressionsmaschine im Kopf“ losgeht.
Großartige, im besten Sinne einnehmende Erzählungen hat Benjamin Maack schon geschrieben. Die Erzählbände heißen „Die Welt ist ein Parkplatz und endet vor Disneyland“ und „Monster“ und so griffig wie die Titel sind auch die Geschichten. Maack arbeitet auch als Journalist, auf ein neues Buch musste man lange warten. Die Neuerscheinung in diesem Frühjahr überrascht auf mehreren Ebenen.
„Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein“ von Benjamin Maack ist im Suhrkamp Verlag erschienen.
„Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein“ liest sich wie ein Logbuch. Die kurzen Texte, keiner länger als einige Seiten, fügen sich zur Geschichte und es tut sich mehr als eine Ahnung davon auf, wie es einem Menschen mit Depressionen ergehen muss. Unter der Überschrift „Funktionieren“ bleibt einmal eine Seite leer. Ein „Fuck“ zieht sich über die folgenden vier Seiten. Selbsthass und Zuversicht, Visite und Sehnsucht. Die größte Anstrengung, nicht bloß zu funktionieren.
"- Ich fühle mich zittrig, vor dem Kino,
- Fruchtgummi kaufen strengt mich ungeheuer an. Ich möchte sterben", heißt es an einer Stelle in diesem Buch, das man mehrmals zur Seite legen, aber unbedingt ganz lesen muss.
Alles darf man dazu fragen, sagt Benjamin Maack am Telefon und nimmt mir das Gewicht und die Vorsicht, in die ich gekippt war. Ein Interview mit dem Autor.
Jetzt ist es eine ungewöhnliche, unangenehme Situation für uns alle: mit Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Ist das für dich vertraut, durch die Ausgangsbeschränkungen in der Psychiatrie? Oder ist es ganz eine andere Situation?
Benjamin Maack: Wir waren tatsächlich [Anm. schon vor den offiziellen Bewegungseinschränkungen in Deutschland] in einer selbst aufgelegten Quarantäne, weil die Familie aus Österreich zurückgekommen war. Einen Tag später hieß es: Menschen, die aus Österreich zurückgekommen sind, sollten sich doch für zwei Wochen in Quarantäne begeben. In der Psychiatrie habe ich es als etwas sehr Positives wahrgenommen, mich nicht um die Außenwelt kümmern zu müssen. Jetzt im Moment bekomme ich in großen Dosierungen meine Familie ab, die beiden Kinder und meine Frau sind hier. Wir haben das Glück, dass wir in einem Haus mit einem kleinen Garten wohnen und dass es nicht ganz so eng ist wie in manchen Wohnungen. Aber es ist natürlich so, dass man sehr viel Reibungspotential hat zwischen den einzelnen. Gerade, wenn man Home-Office machen muss.
Dein Buch „Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein“ ist ja sehr, sehr innig erzählt und dir selbst gegenüber schon sehr brutal. War es ein bestimmter Entschluss, die Depression so akribisch zu studieren und zu dokumentieren?
Nach dem ersten Psychiatrieaufenthalt – das Buch handelt vom zweiten Aufenthalt – habe ich einmal versucht, meiner Frau zu erklären, wie das ist mit Depression. Und ich konnte das nicht mehr. Mein Kopf hat das alles irgendwie in so freundliche, lustige Anekdoten eingekapselt. Es war auch irgendwie schlimm, aber jetzt nicht so, dass man darüber vergessen würde, weiter Bier zu trinken. Und dann habe ich so gedacht: Vielleicht ist das die Chance, meiner Frau und vielleicht auch anderen Leuten zu erklären, wie krass so eine Depression sein kann. Das Projekt war praktisch eine Innenansicht der Depression aufzuschreiben. Ich habe an dem Tag aufgehört, mehr hinzuzufügen, als ich gemerkt habe, ich mache mir gerade eine Notiz in mein Telefon, bei der ich das reflektiere. Genau das wollte ich nicht machen. Reflexionen über Depression gibt es sehr viele.
War das dann ein sehr guter Moment für dich in Bezug auf die Depression?
Im Hinblick auf die Depression kann ich gar nicht sagen, ob es ein guter oder schlechter Moment war. Wenn man depressiv ist – oder bei mir ist es so – dass das einhergeht mit einer ganz starken Geschichtslosigkeit und einer sehr starken Ich-Losigkeit. Man kann sich keine Geschichte von seinem Leben mehr erzählen. Es ist, als würde man in der Depression verschwinden. Als würden die Gedanken einen angreifen, wie so Abwehrzellen bei einer Auto-Immunerkrankung, würden versuchen, einen wegzuschaffen, einen zu zerstören. Und das machen die auch ziemlich gut, muss ich sagen.
Ich bin jetzt im Herbst noch einmal in der Klinik gewesen, ein drittes Mal. Und das war eigentlich ganz gut. Der beste Gedanke, den ich zu meiner Depression habe, ist: Ich hoffe jetzt nicht mehr, dass das irgendwann einmal weg ist, dass es eine Krankheit ist, die ich besiegen muss, sondern ich denke, es ist eher so ein Teil von mir. Ich denke, okay, wenn ich noch einmal ins Krankenhaus muss, dann muss ich eben nochmal ins Krankenhaus. Ein Schiff muss ja auch manchmal aufs Trockendock, damit es repariert werden kann. Manche Dinge kann man halt nicht machen, während es auf den Meeren rumschwimmt. Und dafür geht man in die Klinik.
Depression stellt sich beim Lesen des Buchs ja auch als ständige Gedanken-Hochschaubahn dar, also als ständige Beschäftigung. Das muss unglaublich anstrengend sein. Ist da Schreiben eine Abhilfe? Du würdest jetzt so schnell nicht noch ein Buch zu Depression schreiben wollen, oder?
Nein! Dieses Schreiben könnte vielleicht eine Brücke sein, die den kranken, den depressiven Benjamin mit dem Benjamin, der vielleicht einigermaßen wieder klarkommt, verbindet. Dieses Buch ist ein bisschen wie ein Kästchen, in dem alles drin ist, was in dieser Depression ist und was der Kopf so gerne schnell wieder vergessen möchte. Das ist eigentlich gut, weil man dann wieder ins Machen kommt, weil man vergisst, wie groß dieser Hass war und wie wild diese Selbstverachtung waren. Ich hab jetzt Aufzeichnungen von diesem Ort, aus dem Inneren der Depression, die mich daran erinnern, dass ich da auf keinen Fall wieder hin möchte.
Jetzt wäre die nächste Frage nach dem Vertrauen. Die stellt sich auf mehreren Ebenen, wenn man dein Buch liest. Du hast es jetzt gerade angesprochen: zu dir selbst, von und zu deiner Familie und dann auch den Ärzt*innen gegenüber, denen man vertrauen muss, denen man sich ja auch anvertraut. Mit der Veröffentlichung kommt auch die Frage nach dem Vertrauen zwischen den Lesenden und dem Werk.
Ich glaube, ich bin ein Depressiver, der in einer relativ luxuriösen Situation ist. Ich habe einen Job und meine Chefs wissen, dass ich diese Erkrankung habe und sie gehen damit total gut um. Sie sind wahnsinnig zuvorkommend. Ich habe ein Umfeld, das von dieser Erkrankung weiß und dem ich relativ früh davon erzählt habe, weil ich weiß, dass sie mich dafür nicht verurteilen. Sondern eher versuchen, mir zu helfen. Ich habe das Glück, eine Familie zu haben, eine Frau, mit der ich schon sehr lange zusammen bin. Wir wissen voneinander, dass wir einander lieben. Ich hab zwei gesunde, tolle Kinder. Ich hab keinen finanziellen Probleme, dadurch, dass ich neben meinem Hobby Bücher schreiben eben als Redakteur arbeite. Meine Frau hat auch einen Job. Und diese ganzen Dinge haben viele Menschen, die Depressionen haben, nicht.
Und vor allem, was ganz wichtig ist: Viele Menschen verspüren immer noch eine große Scham, was das angeht. Und ich kann das wahnsinnig gut verstehen. Aber ich glaube, in den Schatten dieser Scham, da warten die größten Ungeheuer. Da wartet das Sich-selbst-etwas-antun. Da wartet das Zerbrechen von Familien, das Rausfallen aus vielleicht Arbeitszusammenhängen usw. Viele Menschen sind sehr hart zu sich und verschließen sich darüber immer mehr, versiegeln sich. Ich glaube, dass es wichtig ist, offen darüber zu sprechen.
Über Depression und besonders über Depression von Männern wird ja noch immer sehr wenig gesprochen, obwohl es immer mal wieder medial aufkommt. Über Selbstmordgedanken wird noch weniger gesprochen. Du thematisierst beides in deinem Buch. Welche Hilfestellungen bietet denn diese Gesellschaft an und welche Maßnahmen wären wichtig in unserem System?
Das Wichtigste ist, bei den einzelnen Leuten anzufangen. Dass sie in irgendeiner Form den Mut bekommen, anzufangen, darüber zu sprechen. Über sich zu sprechen. Ich glaube, das Unausgesprochene ist das, was einen am Ende umbringt. Es ist wichtig, offen darüber zu sprechen. Es gibt eine Szene in dem Buch, wo ich meiner Frau versuche zu erklären, dass ich Selbstmordgedanken habe. Was mir unglaublich schwergefallen ist. Auf der einen Seite dachte ich, das kann ich ihr nicht antun, ihr so etwas zu erzählen. Auf der anderen Seite dachte ich: ‚Jetzt mach dich nicht so wichtig mit Selbstmordgedanken. Oh ich hab Selbstmordgedanken – dagegen sind deine Sachen wohl eher so Problemchen‘. Ich glaube, ganz oft gibt es eine Konstellation, die so geht: Da ist jemand, eine Frau, ein Mann, die oder der ist krank und hat Depressionen und dann gibt es noch eine Beziehung, eine Liebe. Und die kriegt alles erzählt. Aber das ist dann die Sackgasse. Das ist so das Endlager für die ganzen Gefühle. Und ich glaube, das ist die Hölle.
Deshalb habe ich meiner Frau von vornherein gesagt: Auch du kannst mit jedem alles darüber reden. Mach blöde Witze darüber! Alles, was dich entspannt, alles sollst du bitte machen, was dafür sorgt, dass der Druck weggeht.
Das macht es auch Angehörigen sehr schwierig oder Menschen, die nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit Freunden, die depressiv sind. Also was kann denn Sicherheit geben und bieten?
Die Sicht von außen auf den Depressiven finde ich auch wichtig. Oft ist es so, dass wenn die Depressionen stärker werden, man sich trotzdem zwingt, in Situationen zu bleiben, sich dabei aber sehr stark zusammenzieht. Auf andere Leute mag das wirken, als würde man die anderen Leute alle doof finden oder unangenehm finden oder möchte am liebsten, aus Situationen, mag es aber nicht sagen. Die Wahrheit ist einfach so, bei mir zumindest: dass man sich selbst nicht aushalten kann gerade und sich selbst nicht ertragen kann. Da ist es auch wichtig, als Angehörige das nicht zu persönlich zu nehmen, auch wenn das super, super schwer ist. Und gleichzeitig vielleicht auch manchmal der depressiven Person so eine goldene Brücke zu bauen. Meine Frau sagt ganz oft: ‚Benjamin, willst du dich nicht mal kurz hinlegen?‘ Und am Anfang war ich deswegen immer echt sauer, weil ich dachte: ‚Ey! Die denkt gerade, ich funktioniere nicht gut, was soll das denn jetzt!‘ Und das war natürlich wieder so etwas, wo mein Selbsthass super reinklinken konnte und sagen konnte: ‚Oooh du funktionierst nicht gut genug und alle wissen es. Du sollst jetzt schlafen gehen, obwohl du ein erwachsener Mann bist und es ist mitten am Tag!‘ Und dann habe ich mich hingelegt, es hat tatsächlich geholfen.
Oft hilft es eben, wenn jemand anders einen praktisch aus der Situation nimmt, mit so einem Satz, den vielleicht dann beide kennen. Und demjenigen dann halt diese goldene Brücke baut und sagt, du kannst dich jetzt aus der Situation zurückziehen, und dass dann eben auch nicht persönlich nimmt. Ganz wichtig ist: Man kann sich, wenn man Depressionen hat, nur selbst dazu entscheiden, sich Hilfe zu suchen. Andere Leute können das nicht für einen tun. Auch das ist, glaube ich, schrecklich für Angehörige. Aber vielleicht ist es auch eine goldene Brücke für Angehörige zu sagen: Ich ziehe mich aus dieser Beziehung zurück, die macht mich fertig, ich kann ihm*ihr nicht helfen oder ich versuche eben nicht die ganze Zeit, ihm*ihr weiterzuhelfen weiterzuhelfen, sondern ich bin einfach da und mehr kann ich nicht tun.
Die Frage mag banal klingen, doch in Deinem Buch tauchen einige wenige Mal Beschreibungen deiner Facebook-Postings auf und dazu notiert die Anzahl der Reaktionen. Welche Bedeutung hatte Social Media für dich während der Depression?
Für mich war das irgendwie ein Kanal, auf dem eine Form von Normalität irgendwie stattgefunden hat. Ich konnte mich da ausdrücken als eine Person, die ich zu der Zeit grade gar nicht war. Aber von der ich wusste, dass sie da ist. Das hat meine Frau besonders wütend gemacht. Sie hat gesagt: Wir bekommen den kranken Benjamin, und die bekommen den gesunden, super funktionierenden. Das war auf eine Art hart, aber auf eine Art habe ich das auch gebraucht. Dieser Krankheit mit einer Form vielleicht verschachtelter Poesie zu begegnen, wo man gar nicht so ganz offen sagt, das und das ist es jetzt, sondern wo man halt eben einfach in Bildern darüber spricht, wie es einem geht. Und Bilder sind eben ganz wichtig, auch Sprache, um so eine Krankheit in den Griff zu bekommen. Und da waren eben auch diese Sachen auf Facebook wichtig.
Woran schreibst du jetzt?
Ich arbeite seit ungefähr fünf Jahren an einem Science-Fiction-Roman. Weil ich das liebe. Über Science-Fiction zu schreiben ist ein bisschen, als dürfte man eine neue Bibel schreiben. Man darf mit gigantisch großen Bildern Dinge erzählen, die sich dann vor den Augen anderer Leute zusammensetzen und eine Bedeutung haben.
Publiziert am 20.04.2020