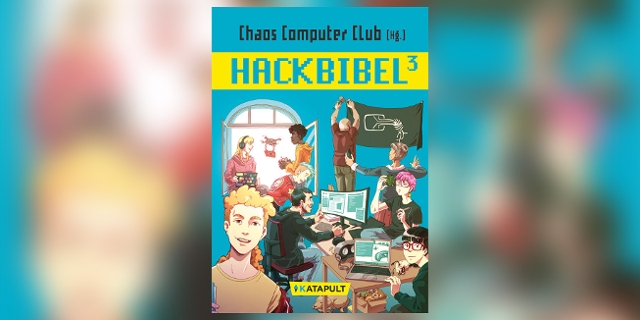Der Vorteil, für verrückt gehalten zu werden
Eine Kolumne von Robert Rotifer
„Lass dich nicht provozieren, das ist nur, was sie wollen“, so hat man mir das als Kind schon erklärt. Und recht hatten sie. Wenn ich mich nicht provozieren hätte lassen, dann hätte der Typ mir auch nicht das Nasenbein gebrochen (andere Geschichte).
Dementsprechend wollte ich auch eigentlich gar nicht mehr drauf reagieren, als am Samstag die Mail und der Daily Express, die zwei größten Maulhelden der britischen Presselandschaft, titelten „Wir werden Kanonenboote schicken“ oder „Kanonenboote, um unseren Fisch zu bewachen“. Solche Synchrontitel kommen natürlich nur mit einem gewissen Maß an Koordination zustande, also per Depesche aus der Downing Street. Und jede Reaktion darauf dient letztlich dem Absender, der bloß ein bisschen Hysterie rund um die Verhandlungen über Fischerei-Rechte erzeugen will, um von der Banalität der sich an den britischen Grenzen bzw. vor dem Fährenhafen von Calais schon jetzt in Form kilometerlanger LKW-Staus entspinnenden Kalamitäten der Bürokratiebombe Brexit abzulenken.
Und trotzdem ist da auch etwas beinahe Mitleid erweckend Tragisches in diesen Überschriften. Ihre Autor*innen wissen, sie schreiben für ein Publikum, das tatsächlich glaubt, die „Foreigners“, sprich der Rest der Welt, zittern immer noch vor der britischen Marine. Ja selbst jene, die nicht daran glauben, sind angehalten, solch kriegerische Empire-Nostalgie wenigstens für eine liebenswerte Schrulle zu halten.
Das gilt übrigens auch für die „Foreigners“, das heißt, deren Dumme sollen sich schon irgendwie wirklich fürchten, die Schlaueren dagegen gefälligst mitschmunzeln. Halbironisch.
In jedem Fall war gut, dass ich diese Kolumne nicht schon am Wochenende im Affekt geschrieben habe, denn da sahen die Aussichten auf einen europäisch-britischen Verhandlungsdurchbruch noch ein wenig trüber aus als jetzt.
Am Donnerstagabend hatte Boris Johnson sich in Brüssel mit dem angeblichen Buzzcocks-Fan Ursula von der Leyen (was britische Medien alles wissen) zum Abendessen getroffen. Einem Gerücht zufolge soll er dabei einigermaßen plump versucht haben, sich mit der deutschen Kommissionspräsidentin ganz im Privaten gegen den EU-Chefverhandler Michél Barnier zu verbünden. Schließlich wüssten die Briten und Deutschen ja beide aus Erfahrung, wie „schwierig“ die Franzosen sein könnten. Die Stimmung rund um den Tisch habe sich von diesem charmant gemeinten Vorstoß nicht mehr erholt. Johnson schien aber bis zum Ende des Abends nicht begriffen zu haben, warum seine flapsige Relativierung des deutschen Eroberungskriegs vor 80 Jahren bei von der Leyen nicht so gut ankam.
Inzwischen gibt es schon andere Lesarten dieses desaströsen Dinners, die das Desaströse selbst zu einer Art paradoxem Triumph umdeuten. Heute Morgen hörte ich im Radio ein Zitat aus einem im Daily Telegraph abgedruckten Kommentar des britischen Ex-Außenministers William Hague: „Es ist immer ein Vorteil, wenn die Gegenseite einen für verrückt genug hält, großen Schaden zu verursachen“.
Okay, wollen wir fair sein, der Satz hatte noch ein Anhängsel: „... großen Schaden zu verursachen, anstatt ein ärmliches Ergebnis zu akzeptieren.“
Das entspricht genau jener From von Logik, die der Ex-Labour-Chef Ed Miliband am Sonntag so treffend charakterisierte: „Das ist, als würde man sagen: Es könnte sein, dass irgendwann das Dach unseres Hauses leckt, also reißen wir es am besten gleich nieder.“
Miliband hat natürlich sachlich recht, schießt in seiner Interpretation von Johnsons selbstzerstörerischer Strategie aber trotzdem am Punkt vorbei. Als Nicht-Psychopath mangelt es ihm da an Einfühlungsvermögen in psychopathische Denkweisen. Hague, der diese offenbar besser versteht, spricht ja ausdrücklich von großem Schaden und Verrücktsein („crazy“ ist das Wort, das er gebraucht). Er ist sich völlig bewusst, dass ein Premierminister, der mutwillig das Wohlergehen seines Landes riskiert, psychisch nicht ganz gesund sein kann und spekuliert darauf, dass sein rationales Gegenüber das erkennt und ihn vor sich selbst bzw. sein Land vor ihm retten wird.
Eine Erpressung wie direkt aus einem John-Le-Carré-Agententhriller eigentlich, gerade in ihrer machoiden Erbärmlichkeit. Ich habe Kollege Chris Cummins wunderbarem gestrigen Nachruf auf den verstorbenen Autor grundsätzlich nichts hinzuzufügen, da steht eigentlich schon alles drin. Nicht zuletzt über den immer über allem stehenden moralischen Kern dieser im Unterschied zum Stereotyp ihres Genres – bei allem Zynismus der handelnden Personen – völlig unzynischen Bücher.
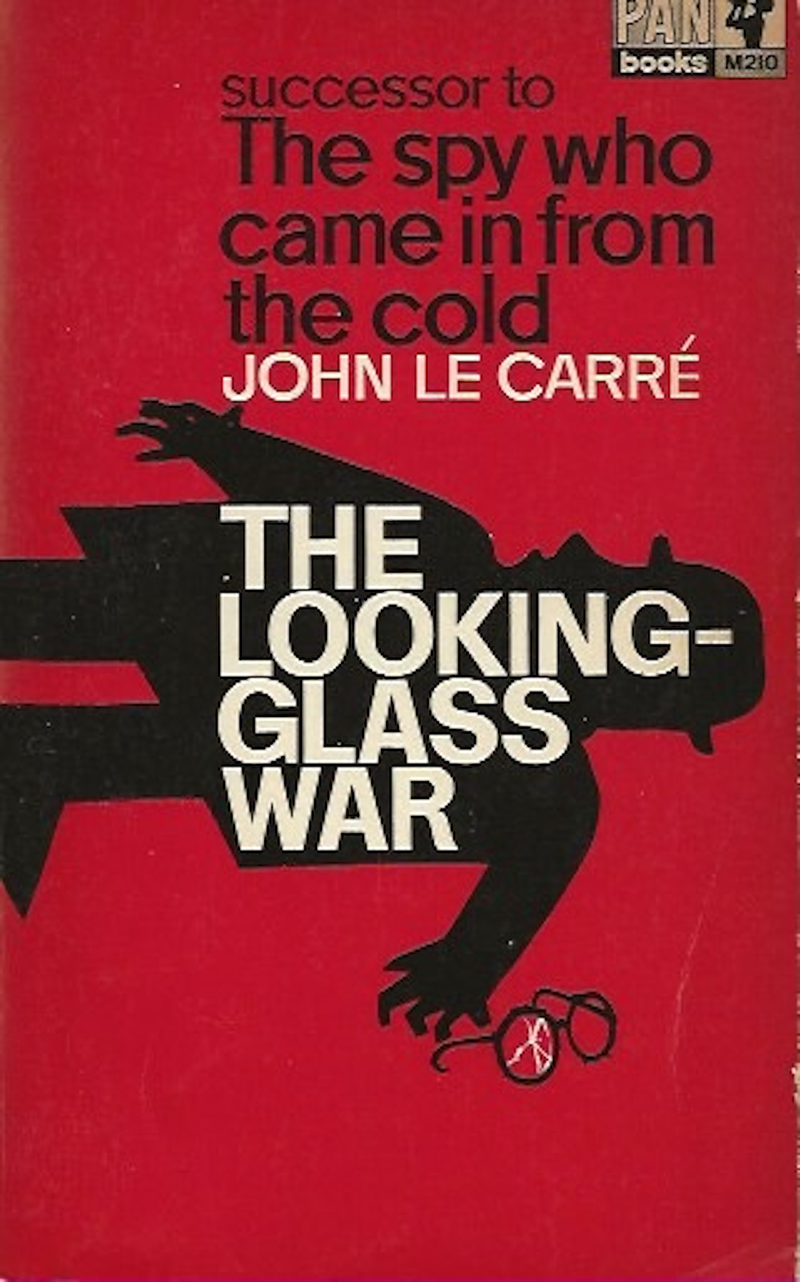
Pan Books
Bloß diese Beobachtung wäre noch hinzuzufügen, auch zum besseren Verständnis dessen, was da gerade in und um Boris Johnson abgeht: Le Carrés Spiongeschichten sind – wie oft bemängelt – tatsächlich sehr männlich, allerdings nicht in der unreflektiert naiven, heroisierenden Art eines Ian Fleming, sondern ganz im Gegenteil: Sie sind detaillierte Studien gekränkter männlicher Eitelkeit, unterdrückter männlicher Emotionen, die sich in toxischen Machtspielen entladen.
Der „Circus“ rund um seinen innerlich permanent geknickten Helden George Smiley mit der kalten Vaterfigur Control, dem Verräter Bill Haydon, Toby Esterhase, Jim Prideaux, Peter Guillam, Percy Alleline, aber auch der sowjetische Gegenspieler Karla, ist letztlich eine Soap mit rein männlichen Charakteren, deren Intelligenz aber auch deren soziale Störungen sich in den mit gegenseitigem Misstrauen geladenen, unterkühlt sarkastischen Codes ihrer Kommunikation äußern. Und in den Vorwänden, unter denen sie einander umbringen. Vorwände, die am Ende nur mehr mit ihrem Verhältnis zueinander und rein gar nichts mit den „höheren“ Zielen des Kalten Kriegs zu tun haben. In Connie Sachs gibt es sogar eine weibliche Figur, die die bis zum Verb-Verzicht verknappte Sprache der Männer spricht, in deren Intrigenspiel, das sie überblickt, aber nur als Einflüsterin interveniert.
Nun halte ich zwar den Brexit nicht für dezidiert männlich, dafür hat er viel zu viele Mütter in Politik und Medien, von Theresa May über Gisela Stuart, Priti Patel, Suzanne Evans, Claire Fox, Sarah Vine, Julia Hartley-Brewer, Katie Hopkins, Kate Andrews, Andrea Jenkyns bis Suella Braverman, die allesamt nicht aus seiner Geschichte herausgeschrieben werden sollten.
Die Tatsache, dass ihr von praktisch allen Erwähnten außer May noch nie gehört habt, weil ihre Rolle sich ebenfalls auf die von Einflüsterinnen und Weggefährtinnen beschränkt, spricht allerdings auch Bände. Und die Art, wie May schließlich von Johnson abserviert wurde, natürlich genauso.
Was ich jedoch für eine stereotypisch männliche Konditionierung halte, ist die zu Anfang dieser Kolumne von William Hague beschriebene Form der emotionalen Erpressung. Sehr grob gesprochen: Von der Leyen soll denken, dass dieser Mann tatsächlich bereit ist, die Kinder umzubringen, weil ihm die Scheidungsvereinbarung nicht passt.
Aber zurück zu Le Carré: Sein letzter Roman „Agent Running In The Field“ war sein bewusst als solches angelegter Kommentar zum Brexit. Ein gutes, aber sicher nicht sein bestes Buch. Auch nicht über den Brexit.
Das war nämlich The Looking Glass War, geschrieben 1965, also noch Jahre bevor das Vereinigte Königreich dem Europäischen Wirtschaftsraum beitreten sollte, der zur Zeit seines Erscheinens bei Kritik und Publikum ziemlich schlecht angekommene Nachfolgeroman seines ersten großen Bestsellers „The Spy Who Came In From The Cold“.
Der dümmliche Klappentext meiner irgendwann zufällig von einem ausmistenden Nachbar geerbten, vergilbten Ausgabe zeigt, dass der amerikanische Taschenbuch-Verlag Bantam das Buch 1981 genauso gründlich missverstand wie Regisseur Frank Pierson 1970 in seiner schwer misslungenen Verfilmung: „Le Carrés Held hat eine Mission. Er weiß, dass sie gefährlich ist. Er hat seine Befehle...“

Columbia Pictures
Agent küsst seinen Chef, aus der Verfilmung von The Looking Glass War, 1970"
Blödsinn. Dieses Buch hat keinen Helden, es ist vielmehr eine knochentrockene Satire über das Verhängnis britischer Kriegsnostalgie, Europhobie und verblendeten Exzeptionalismus.
Sehr boshaft beschreibt Le Carré darin die intellektuelle Ärmlichkeit und verletzte Arroganz einer geheimdienstlichen Abteilung des Ministry of Defense, die zwanzig Jahre nach Ende des Kriegs endlich auch wieder einmal im Mittelpunkt stehen will, mit antiquierten Methoden Phantome von Atomraketen jagt und dabei völlig sinnlos eine schwere diplomatische Krise verursacht (George Smiley kommt den unfähigen Kollegen schließlich zur Hilfe).
Dass Muttersprachler*innen der Witz dieser Geschichte so völlig entgehen konnte, ist nicht Le Carrés Schuld, sondern belegt bloß die damals schon fortgeschrittene Normalisierung real existierender, angloamerikanischer Hybris.
Le Carré hatte unter seinem bürgerlichen Namen David Cornwell in den späten Fünfzigern bis frühen Sechzigern bekanntlich selbst als Spion gearbeitet. Seine Skepsis gegenüber der Weisheit der sogenannten Intelligence Services wurde aber schon lange davor geweckt, als er 1950 im Alter von 18 Jahren im Präsenzdienst (National Service) als britischer Besatzungssoldat in Graz als Übersetzer bei Verhören von Flüchtlingen aus dem Osten eingesetzt wurde.
In „The Ratline“, dem jüngsten Buch des Menschenrechtsexperten Philippe Sands, einem von Cornwell/Le Carrés Londoner Nachbarn, über den Vatikan und den amerikanischen Geheimdienst als Fluchthelfer prominenter Nazis am Beispiel des österreichischen Kriegsverbrechers Otto Wächter (als “Die Rattenlinie“ auf deutsch veröffentlicht) kommt in Kapitel 40 (Titel „Persilschein“) genau diese Zeit zur Sprache.
Sands sucht einen Experten, der ihm bei der Deutung der Geheimdienstdokumente hilft, die er im Zug seiner Recherchen über Wächter gefunden hat, und weckt dabei in Cornwell/Le Carré Erinnerungen daran, wie Briten und Amerikaner damals in Österreich aktiv flüchtige Nazis als Verbündete für den Kalten Krieg rekrutierten. Sands zitiert Cornwell/Le Carré wörtlich: „Es war verwirrend. Ich war dazu erzogen worden, den Nazismus und all dieses Zeug zu hassen. Plötzlich festzustellen, dass wir uns völlig gedreht hatten und der große Feind nun die Sowjetunion war, das war sehr verblüffend.“
Auch daran musste ich denken, als ich von Boris Johnsons mutmaßlichem, plumpem Versuch las, sich mit Ursula von der Leyen gegen Michél Barnier und „die schwierigen Franzosen“ zu verbünden. Denn irgendwo tief im verzerrten Weltbild der nostalgischen britischen Rechten ruht auch eine Tendenz, die es immer noch bedauert, in zwei Weltkriegen auf derselben Seite wie Frankreich gegen Deutschland gekämpft zu haben, zu dem man sich (im Falle des Königshauses ganz konkret) trotz aller bei Gelegenheit hervorgeholter Germanophobie immer noch irgendwie näher fühlt als zu den Nachbarn auf der anderen Seite des Kanals.
Diese vom teutonischen Klischee faszinierte Tendenz hat freilich nichts mit der leidenschaftlichen, privaten Germanophilie eines David Cornwell/John Le Carré zu tun. Sie gehört vielmehr in eine Welt, in der Männer mit verletzten Egos mit Kanonenbooten drohen und bei Verhandlungen lieber großen Schaden anrichten, als ein ärmliches Ergebnis zu akzeptieren.
Was Großbritannien gerade durchmacht, ist im Grunde eine Fortsetzung von „The Looking Glass War“. Einschließlich der Tatsache, dass auch diesmal weder Akteur*innen noch Presse, noch Publikum bemerken, dass sie sich eigentlich in einer Satire befinden.
Publiziert am 15.12.2020