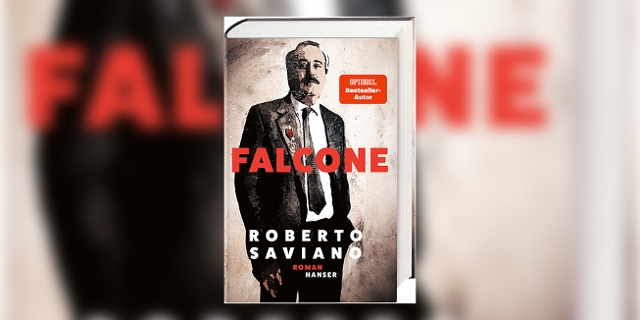Welche Rolle Memes beim Sturm auf das Kapitol gespielt haben
Von Ali Cem Deniz
Was mit Gestalten wie Pepe the Frog und Wojak angefangen hat, hat vergangenen Mittwoch mit dem Q-Anon Schamanen, der in einem Barbarenkostüm durch die Hallen des Kapitols marschiert ist, seinen (vorläufigen) Höhepunkt gefunden. Eine Woche ist es jetzt her, dass tausende Trump-Anhänger*innen den Sitz des US-Kongresses gestürmt haben, in der Hoffnung, ihren Präsidenten trotz Wahlniederlage an der Macht zu halten. Dabei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Polizist wurde zu Tode geprügelt, eine Demonstrantin wurde beim Versuch, Barrikaden zu durchbrechen, vom Secret Service erschossen.
Memes statt Statements
Zu diesen Ereignissen gibt es bis heute kein offizielles Statement der US-Behörden. Dafür gibt es eine Fülle an Bildern und Videos, die sowohl durch die klassischen als auch sozialen Medien geistern. Dystopische Visionen vom Kapitol in einem Nebel aus Tränengas wechseln sich ab mit skurrilen und fast schon lustigen Gestalten.
Die Bilder, die im Chaos der Ereignisse entstanden sind, sind kein Zufall, sagt Politologin Karin Liebhart, die zu visueller politscher Kommunikation und Rechtsextremismus forscht. „Sie arbeiten auch mit Memes und ziehen sich dann auf die Position zurück, dass das alles Ironie und Satire wäre“, sagt Liebhart. Selbst wenn die Memes und Kostüme billig und banal wirken, ist die Versuchung groß, sie zu teilen. Auch wir bei FM4 haben Bilder geteilt und dafür viele Emojis und Likes geerntet.
Der Impuls, die Bilder zu teilen, ist nicht unbedingt falsch, sagt Liebhart und könne auch Teil einer kritischen Auseinandersetzung sein. „Solche Bilder gab es bisher nicht und das verführt im ersten Moment, das zu teilen, auch vielleicht mit einem kritischen Anspruch und so die Geschichte dennoch weiter zu erzählen.“
Erst in den darauffolgenden Tagen tauchen andere Bilder auf, von para-militärischen Uniformen, Waffen und Kabelbindern, die wohl bei Geiselnahmen zum Einsatz kommen sollten.
Ironie gegen Kritik
Die vermeintlich ironische Natur der Aktionen bietet den Rechtsextremen neues Meme-Material und dämpft die Kritik an ihnen ab. Es entsteht stellenweise fast der Eindruck, das Ganze sei ein Streich gewesen, der etwas zu weit ging. Doch dieser Eindruck täuscht und Karin Liebhart erkennt in den Bildern eine visuelle Strategie, die die neuen Rechten schon lange verfolgen.

APA/AFP/ALEX EDELMAN
Bilder lösen starke Emotionen aus und sie bleiben uns in Erinnerung. Es ist nahezu unmöglich geworden, an die Stürmung des Kapitols zu denken, ohne dabei den Schamanen vor dem geistigen Auge zu haben. Doch erst ein genauer Blick zeigt, was sich in den Bildern versteckt: rechtsextreme Symbole und Flaggen, Trump-Fans, die bewusst vor Porträts von Sklavenhaltern posieren. Um diese Propaganda zu entschlüsseln, sollten wir lernen, nicht nur Texte, sondern auch Bilder zu lesen, meint Karin Liebhart.
Erst dann wird klar: Der Sturm auf das Kapitol war nicht ein bizarres kontextloses Spektakel. Es hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte.
FM4 Auf Laut: Der Sturm auf das Kapitol und die Folgen
Hunderte Trump-Fans stürmen bewaffnet das US-Kapitol. Angestachelt vom scheidenden Präsidenten Donald Trump, der von seinen Wahlbetrugs-Vorwürfen nicht abrückt. Rechtspopulist*innen, Verschwörungstheoretiker*innen, White Power-Nazis sind weiter auf dem Vormarsch: Der kommende Präsident warnt vor „Domestic Terrorists“.
Sind die Ausschreitungen in Washington nur der Auftakt für immer wiederkehrende Angriffe? Ist der schonende Umgang mit den Täter*innen ein Zeichen für ein kaputtes System, das seit jeher auf weiße Vorherrschaft aufbaut? Wie groß ist die Gefahr für die Demokratie in den USA?
Claudia Unterweger diskutiert mit Politikberater Yussi Pick, Politikwissenschaftlerin Araba Evelyn Johnston-Arthur von der Howard University und mit FM4-Hörer*innen. Am Dienstag, 12.1. ab 21 Uhr on air und 7 Tage lang im FM4 Player. Anrufen und mitdiskutieren unter 0800 226 996.
Publiziert am 12.01.2021