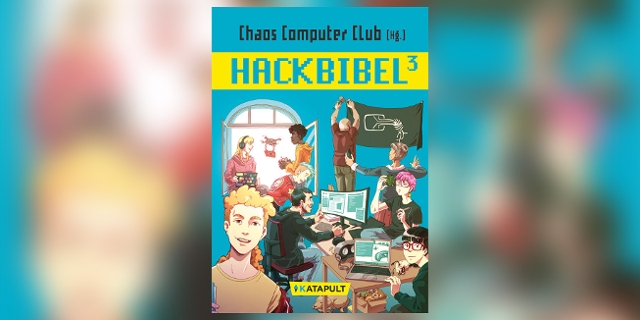Phil Spector 1939–2021
Von Robert Rotifer
Stellen wir das Erste einmal gleich zu Anfang klar: Phil Spector war, nach allem, was über sein persönliches und berufliches Leben bekannt ist, ein Monster.
Ein verurteilter Mörder, ein gewalttätiger, zutiefst manipulativer Machtmensch, dessen persönliche Probleme nicht im Geringsten zur Entschuldigung oder Relativierung seiner Verbrechen – vor allem an den Frauen in seinem Leben – gereichen.
Abgesehen davon war er auch einer der Architekten des vielzitierten Wall of Sound und Urheber einiger fundamentaler Grundbegriffe dessen, was wir seit den letzten sechs Jahrzehnten als Popmusik verstehen.
Das Echo des von ihm geprägten Girl-Group-Sound der frühen 1960er hallt über die Jahrzehnte bis heute nach, ob in den Platten von Bruce Springsteen, den Ramones, The Jesus And Mary Chain und ihrer vielen Imitator*innen, Amy Winehouse, Lana Del Rey oder den Plug-ins jeder für Pop-Produktionen verwendeten Software.
Als am Sonntag bekannt wurde, dass der 81-Jährige in einem kalifornischen Gefängnis an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben ist, ging in den sozialen Medien die übliche Debatte darüber los, ob man einen Künstler mit „problematischer“ Persönlichkeit verehren bzw. sein Werk unabhängig von seinen sonstigen Taten schätzen darf.
So oft diese Fragen gestellt werden, so oft zielen sie auch am Kern vorbei, schließlich gehört es zum Wesen von Popsongs, dass sie, sobald sie ins Leben ihres Publikums treten, jenen gehören, die sie hören, und nicht mehr ihren Interpret*innen, Autor*innen und Produzent*innen.
Phil Spectors Fingerabdrücke finden sich auf viel zu vielen Seiten der Popgeschichte, um sie ausradieren zu können, aber der Gedanke wäre auch völlig unsinnig.
Denn im Endeffekt war Phil Spectors Gewalt, vor allem – aber nicht nur – gegen Frauen, auch kein bedauerlicher, privater Makel, sondern eine ziemlich typische Erscheinung des Systems einer aus der zutiefst hierarchischen Entertainment-Welt der Nachkriegszeit hervorgegangenen Popkultur, die die Gesellschaft rund um sich immer schon genauso reflektierte wie herausforderte.
Es ist also kein Zufall, sondern ganz logisch, dass dieses Business einem moralisch und menschlich gescheiterten Mann wie Phil Spector bis zu seiner Verurteilung als Mörder eine Heimat in seiner Mitte bot.
Und erst jetzt, wo das alles gesagt ist, können wir auch über Phil Spectors Musik reden.
1939 in der New Yorker Bronx als Harvey Phil Spector, Sohn jüdisch-ukrainischer Einwander*innen geboren, erlebte er als neunjähriges Kind den Selbstmord seines Vaters. Aus der Inschrift auf dessen Grabstein „To Know Him Is To Love Him“ machte er zehn Jahre später den Titel seines ersten, mit seiner damaligen Band The Teddy Bears eingespielten, großen Hits.
Der 19-jährige Spector war nicht nur der Autor, sondern auch der Arrangeur und Produzent jenes Songs. Die Hauptstimme überließ er aber einer Frau, Carol Connors, in deren Interpretation das Lied sich zu einem dramatischen Bekenntnis der unterwürfigen Liebe zu einem unzähmbaren, mysteriösen männlichen Wesen verwandelte – ein Rezept, das Spector nach der Gründung seines eigenen Labels Philles Records (1961, mit dem PR-Mann Lester Sill) zur Perfektion bringen sollte (im verlinkten Mitschnitt eines TV-Auftritts der Teddy Bears ist Spector der Typ rechts mit der Gitarre).
De facto ist Phil Spector einer der frühen Urheber der Idee des Independent-Labels, das seine eigene Ästhetik, seinen eigenen Sound definiert und dabei die geltende Orthodoxie der Musikindustrie über den Haufen wirft. Ja mehr noch, Spector war der Produzent, der den Sound als die zentrale Qualität einer Popsingle und – um das mit seinem Namen so untrennbar verbundene Klischee zu bedienen – das „Studio als Instrument“ begriff.
Bloß weil es immer gesagt wird, ist es noch lange nicht falsch: Mit dieser Konzentration auf den Sound beginnt im Pop die Moderne.
Spectors wichtigste technologische Waffe, bzw. die seines Tontechnikers Larry Levine, waren dabei die berühmten Echokammern der Gold Star Studios in Los Angeles, wo eine im Jargon der Branche ironisch als The Wrecking Crew bezeichnete Besetzung der größten Studiomusiker*innen ihrer Zeit, meist unter der Regie von Jack Nitzsche und Sonny Bono, in großer Besetzung samt Streichern, Bläsern und jeder Menge Percussion jenen breiten Teppich legte, auf dessen dichten Maschen dann die Melodien in Form von – zumeist weiblichen – Chören schimmern konnten.
Spector sprach selbst prätentiös von seinem „wagnerianischen“ Zugang zu Popsingles, die er zu orchestralen „Symphonien für die Kids“ aufblies. In Wahrheit bargen sie eine weit engere Verwandtschaft zur kontemporären Konkurrenz von Film und Fernsehen, nicht zuletzt in ihrer Verwendung von Soundeffekten wie etwa dem Wolkenbruch am Anfang von „Walking in the Rain“, einer Popsingle als Hörspieldramolett.
Tatsächlich waren Spectors Produktionen der Girl-Group-Ära bei weitem nicht die technisch besten, geschweige denn saubersten Produktionen ihrer Zeit, sondern vielmehr perfekt zugeschnitten auf das Medium ihrer Konsumation:
Die so laut wie möglich umgeschnittene Seven-Inch-Single in der Jukebox, deren Klang den Lärm jeder Teenager-Milch-Bar übertönen musste und vor allem die aus den monauralen Lautsprechern Abertausender amerikanischer Autoradios tönenden limitierten Frequenzen der in den USA den Popmarkt dominierenden Mittelwellensender.
Die Definition der einzelnen Instrumente war dabei nicht bloß nachrangig, ganz im Gegenteil: Die vielen Doppelungen in Spectors/Nitzsches Arrangements waren ganz darauf angelegt, sich zu einem undefinierbaren, magisch mächtigen Ganzen zu vermengen.
Nachdem das menschliche Gehör sich bei solch systematischer Überforderung vorzugsweise an den höchsten Stimmen eines Arrangements orientiert, brauchte es helle Frauenchöre, um sich gegen diesen komprimierten Wall of Sound durchzusetzen.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Phil Spectors Produktionen sich gerade deshalb auch so gut für das heute bevorzugte Abhörmedium, den vom Miniatur-Speaker eines Smartphones wiedergegebenen MP3-Stream eignen.
Die andere Ironie ist, dass gerade im Youtube-Zeitalter der frei verfügbaren Archiv-Clips alter Pop-Fernseh-Shows das das von der Geschichtsschreibung gepflegte Augenmerk auf Phil Spector als allmächtigen Drahtzieher wieder zurück auf die Frauen rückt, die diese Songs ursprünglich vor einem Publikum verkörperten, das sich vermutlich wenig darum kümmerte, wer bei der Originalaufnahme im Regieraum gesessen war.
Das Paradoxon des Girl-Group-Booms der frühen Sixties war, dass er nach der maskulinen Rock’n’Roll-Ära eine weibliche Sicht auf Liebe und Sexualität in den Vordergrund stellte, auch wenn eine Menge männliche Projektion dahintersteckte.
Und dass - in einer Zeit, da das Wort „soul“ noch gemeinhin für „Seele“ und sonst gar nichts stand - plötzlich glamouröse, afroamerikanische Frauen in der weißen Welt des US-Fernsehens zu sehen waren.
In seiner Glanzzeit produzierte Spector Soundtracks für die emotional und hormonell aufgeladenen Teenagerjahre der Boomer-Generation, von „Da Doo Ron Ron“, „Be My Baby“, „Then He Kissed Me“ und „He’s A Rebel“ über „Baby I Love You“ bis zu „Uptown“, geschrieben auf Augenhöhe mit dem Publikum von den jungen Songwriter*innen des New Yorker Brill Building, darunter Gene Pitney und Frau/Mann-Teams wie Ellie Greenwich/Jeff Barry, Carole King/Gerry Goffin und Barry Mann/Cynthia Weill, gesungen von Girl Groups wie den Crystals oder Ronettes, aber auch den Righteous Brothers („You’ve Lost That Loving Feeling“) und Ike & Tina Turner („River Deep, Mountain High“).
Letztere Single aus dem Jahr 1966, eines von Spectors letzten Werken seiner ersten Schaffensphase, wird gern als der Höhepunkt seiner Produktionstechnik zitiert. In den Ohren dieses Nachrufers markiert sie dagegen vielmehr den Punkt, wo der Wall of Sound in einen diffusen Wash of Sound kippte.
Spectors Vorstellung eines idealen Mix war Mono, zielte also aus einer Richtung auf das Ohr der Hörerin. Die Entwicklung der Pop-Produktion hin zum transparenteren Medium des Stereo-Mix ließ Spectors Wall of Sound in der zweiten Hälfte der Sixties bereits überholt klingen.
Gleichzeitig drang gegen Ende des Jahrzehnts mit dem unaufhaltsamen Erwachsenwerden sowohl der Bands als auch ihres Publikums eine selbstreflexive Nostalgie in die Popästhetik vor. Die Beatles etwa hatten zwar Spectors Sound aus den Charts verdrängt und dem Albumformat zum Triumph über die bis dahin den Popmarkt beherrschende Single verholfen, sie waren aber auch selbst mit seinen Produktionen aufgewachsen (und hatten diese auch mit umgekehrten Geschlechterrollen gecovert).
Insofern war es also nur zu logisch, dass John Lennon – ohne Wissen bzw. sehr zum nachträglichen Leidwesen Paul McCartneys – Spector den Auftrag gab, einen Haufen unfertiger Aufnahmen zum letztem Album der Band, „Let It Be“, mit ein bisschen Instant-Wall-of-Sound-Behandlung aufzupeppen.
Lennon, der dem Klang seiner eigenen Stimme nicht vertraute, fand in seiner Solokarriere auf Alben wie „Plastic Ono Band“, „Imagine“, „Some Time in New York City“ und „Rock’n’Roll“ im während der Siebzigerjahre zunehmend erratischen, neurotischen Spector einen willigen Verbündeten, wenn es darum ging, seine Stimme in brachiales Slapback-Delay zu tauchen (im Fall von „Instant Karma“ tat er das auch mit dem Schlagzeug, siehe verlinktes Video).
Weite Strecken von George Harrisons Solo-Showcase „All Things Must Pass“ (1970) verarbeitete Spector durch exzessiven Gebrauch von Hall in einen feuchten Brei, der in seiner monumentalen Überdimensionierung andererseits aber auch zur megalomanischen Geste des Dreifach-Albums passte. Im Nachhinein vermeint man herauszuhören, wie die Musik im betäubten Bewusstsein des beduselten Produzenten immer weiter in die Ferne rückte.
Sieben versoffene Jahre später erschien eines von Spectors größten Meisterwerken in Form der berüchtigten LP „Death of a Ladies’ Man“ von Leonard Cohen (1977).
Die bedenklichen Umstände seiner Entstehung wurden gern und oft weitererzählt und ausgeschmückt, aber wir dürfen es als belegt betrachten, dass Spector dabei den mit seinen Produktionsmethoden hadernden Cohen mit gezogener Waffe bedrohte und aus dem Studio warf.
Was immer der damals selbst keinesfalls trittsicher nüchterne Singer-Songwriter von Arrangement und Mix halten mochte, aus Hörer*innenperspektive versprühen brutal selbstbeschädigend explizite Songs wie das Titellied, „Paper Thin Hotel“ oder „Don’t Go Home With Your Hard-On“ (mit Backing Vocals von Bob Dylan und Allen Ginsberg) noch heute eine dank Cohens selbstironischer Sabotage seiner eigenen Intelligenz unwiderstehliche, schmuddelige Atmosphäre.
Das ändert freilich nichts an der Tatsache, dass der offensichtlich außer Kontrolle geratene, mit Pistolen fuchtelnde Produzent damals schon längst in psychiatrischer Behandlung hätte sein sollen, anstatt samt seiner bis an die Zähne bewaffneten Entourage den ihm anvertrauten Künstler zu tyrannisieren. Der Grad, zu dem das System Musikindustrie Wiederholungstäter wie Spector wegen seines legendären Rufs zu dulden bereit war, war für sich schon kriminell. Mit tödlichen Konsequenzen.
Als Phil Spector 2003 auf seinem kalifornischen Anwesen die 40-jährige Schauspielerin Lana Clarkson erschoss, war das einzig Überraschende daran eigentlich nur, dass so etwas nicht schon viel früher geschehen war.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Leidensgeschichte seiner zweiten Frau, Veronica Bennett, als Ronnie Spector die Lead-Sängerin der Ronettes, in diesem Nachruf noch einmal aufgerollt werden sollte. Wie Spector sie vor lauter Eifersucht gegen ihren Willen jahrelang von der Außenwelt entfernt als Geisel gefangenhielt. Oder wie er mit einer Freundin seine Adoptivsöhne mutmaßlich sexuell missbrauchte.
Das sind Dinge, die einerseits zum Gesamtbild seines Lebens gehören, deren endlose Nacherzählung seine Opfer aber erst recht zu Teilen seines Mythos des „komplexen Genies“ degradiert.
In ihrem Tweet von gestern spricht Ronnie Spector für sich selbst:
Working with Phil Spector was working with the best. So much to love about those days.
— Ronnie Spector (@RonnieSpectorGS) 17. Januar 2021
Falling in love was like a fairytale.
The magical music we made was inspired by our love.
He was a brilliant producer, but a lousy husband.
The music is forever 1939-2021 pic.twitter.com/x2ltPa1frq
Ich hatte zu Anfang dieses Texts ja schon geschrieben, dass Phil Spectors Verhalten, ehe sein Waffengebrauch überhandnahm, keine individuelle Verirrung, sondern ganz symptomatisch für das prä-feministische Zeitalter war.
Keine Phil-Spector-Produktion macht das so graphisch klar wie der Crystals-Song „He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)“, geschrieben von der damals 20-jährigen Carole King und ihrem 21-jährigen Mann Gerry Goffin über ihre Babysitterin, die regelmäßig von ihrem Freund verprügelt wurde. Als Goffin und King sie fragten, warum sie sich das gefallen ließe, behauptete das Mädchen, dass ihr Freund ihr damit seine Liebe zeige. Die wie ein feierlicher Trauermarsch vorgetragene Crystals-Version des Songs bleibt eines der schaurigsten Dokumente der Popgeschichte.
Die Babysitterin hatte später übrigens als Little Eva mit dem von Goffin/King geschriebenen Song „The Loco-Motion“ selbst einen Hit, keine Phil-Spector-Produktion, wohlgemerkt, aber eindeutig unter seinem Einfluss.
Phil Spector also war ein Monster in einer Monsterwelt, und im brüchigen Glanz seiner Produktionen lauerte bereits gut hörbar jene Düsternis, die später ein David Lynch bildlich zum Vorschein bringen sollte.
Aber an Spectors Wall of Sound kleben heute immer noch über Jahrzehnte angesammelte, dicke Schichten kollektiver Erinnerungen an hyperreales Herzleid und verwundbare Teenager-Sentimentalität, in die sich erstaunlicherweise sogar Menschen einfühlen können, deren Eltern noch nicht geboren waren, als diese Lieder einst in die Welt gesetzt wurden.
Während ich das hier geschrieben habe, habe ich eines nach dem anderen davon gehört, und beruhigt festgestellt, dass sie nichts von dieser augenblicklichen Wirkung verloren haben. Ihr Schimmer bleibt immun und unberührt vom Tod des Mörders Phil Spector.
Publiziert am 18.01.2021