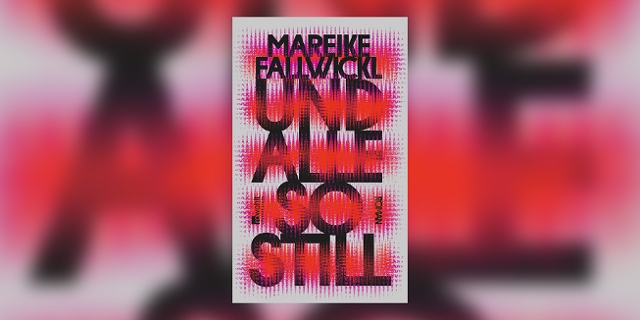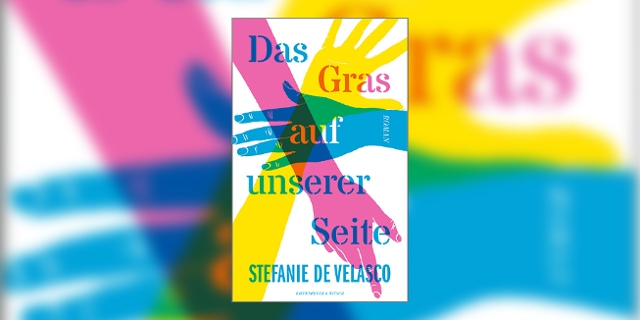„Die Eroberung Amerikas“ ist ein einzigartiges Theater der Grausamkeit
Von Melissa Erhardt
Man kennt sie eigentlich, die spanischen Eroberer: Christopher Kolumbus, Francisco Pizarro, Hernán Cortés. Sie haben die Azteken in Tenochtitlan geschlagen, die Inka in Cajamarca und dabei die indigene Bevölkerung brutal vertrieben, versklavt, getötet oder vergewaltigt.
Weniger bekannt ist ein gewisser Hernando de Soto, ein Spanier aus der Extremadura, der bereits mit Pizarro in Peru gewesen war, wo er dem Inka-König Atahualpa angeblich Schach und Spanisch beigebracht hatte – bevor die Spanier ihn in eine Falle lockten und töteten. De Soto leitete im 16. Jahrhundert eine der ersten europäischen Expeditionen in die Südstaaten der USA, nach Florida, die bis heute als der „erfolgloseste Eroberungszug der Spanier“ gilt. Als Franzobel diesen Satz vor vier Jahren in einer Sondersendung über Amerika hört, beschließt er, einen Roman darüber zu schreiben. Und der hat es in sich.
Der Konquistador und seine „Buberlpartie“
1538 macht sich also Hernando de Soto, von Franzobel kurz Ferdinand genannt, mit der finanziellen Unterstützung von Kaiser Karl V. und 712 Mann über La Gomera und Kuba auf dem Schiffsweg nach Florida. Ihr Ziel: Das rühmliche „Eldorado“ finden, das Land des Goldes, das angeblich auf dem unbekannten Kontinent versteckt liegt. Statt auf Gold stoßen Ferdinand und seine Gefolgschaft aber auf einfach-lebende indigene Stämme denen man versucht, den christlichen Glauben aufzudrängen:
„Ihr Kaziken und Indios auf diesem Festland! Ferdinand brüllte. Hiermit tun wir kund, dass es einen Gott gibt, einen Papst und einen König in Kastilien, der Herr dieser Länder ist. Kommt und leistet ihm gehorsam und wisst, wenn nicht, werden wir Krieg führen gegen euch, euch töten oder gefangen nehmen.“
Und da sich viele Stämme gegen die fremden Weißen wehren, legt man den Männern Ketten an und vergewaltigt die Frauen. Versuchen sie zu entkommen, hetzen Ferdinand und die anderen „Helden“ Doggen auf sie, die sie im Nu zerfleischen. Oder sie hacken ihnen die Hände ab, brennen ihre Dörfer nieder und plündern, was sie bekommen. In anderen Dörfern begehen die Stämme Massenselbstmorde, da sie lieber sterben, als sich von den Spaniern versklaven zu lassen. In wieder anderen sterben die Indios ohne Gewaltanwendung, da die Spanier und die von ihnen mitgebrachten Tiere Krankheiten verbreiten, denen die Indios ausgeliefert sind.
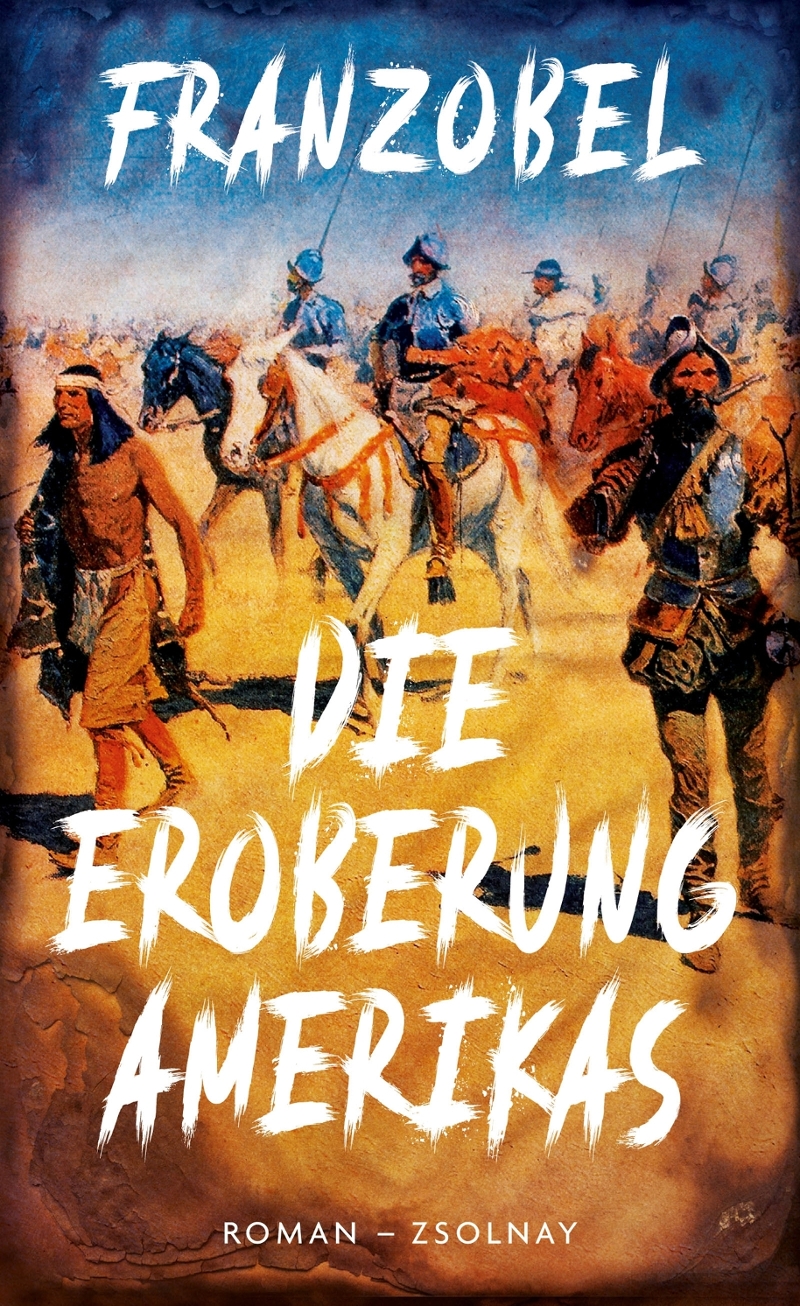
ZSOLNAY
Der Roman „Die Eroberung Amerikas“ ist am 25. Jänner im Zsolnay-Verlag erschienen.
Brutale Realität
Franzobel nimmt sich beim Schreiben kein Blatt vor den Mund. Er beschreibt das 16. Jahrhundert als raue, anstandslose Zeit, in der Andersdenkende enthauptet, Gotteslästerern die Zunge abgeschnitten und sogenannte „Kindesmörderinnen“ ertränkt werden. Erzählt wird aus einer allwissenden Sicht, die an kolonialen und degradierenden Bemerkungen nicht spart. So beschreibt der Erzähler indigene Frauen als „butterhüftige Indianerinnen“ mit „biegsamen braunen Körpern“. Er begibt sich damit auf gefährliches Terrain und manchmal wäre hier weniger vielleicht mehr gewesen. Vielleicht wird aber erst dadurch die unfassbare Grausamkeit der Eroberer greifbar, die bei uns viel zu lange als Helden gefeiert worden sind. Denn warum verschleiern, was wirklich passiert ist?
So sieht man im Laufe des Romans auch die Wandlung von Ferdinand von einen anfangs recht empathischen Antihelden zu einem eifer- und herrschsüchtigen Eroberer, der immer mehr mit einem Gott-Komplex zu kämpfen hat. In Panama zeigt er sich noch menschenfreundlich, versucht, seine spanischen Kumpanen zu überreden, dass sie „diese Menschen“ (gemeint sind die Indigene) nicht so behandeln dürfen:
„Die Mütter kümmern sich genauso um ihre Kinder wie die Christinnen. Sie beten zu ihrem Gott wie wir. Wie wir lachen sie, träumen, spielen, verehren ihre Ahnen. Und wenn man ihnen die Haut aufschneidet, kommt Blut heraus, kein Himbeersaft“
Aber eine Mischung aus toxischer Männlichkeit, kapitalistischer Gier und dem Drang nach der weißen christlichen Vorherrschaft verderben ihn nach und nach. Irgendwann sieht auch er in den Indigenen keine Menschen mehr.
„Vor sieben Jahren in Peru, als er Atahualpas obersten General foltern ließ und zusah, wie ein Nonnenkloster zerstört und die „Jungfrauen der Sonne“ vergewaltigt wurden, war er nicht gleichgültig geblieben, Jetzt empfand er wenig, war er abgestumpft wie ein Chirurg, der tagein tagaus an Körpern schnipselt. Seine Psyche hatte sich verschanzt, damit nichts mehr zu ihm durchdrang.“
Coca Cola, Ikea und Mitú
Franzobel springt in seinem Roman immer wieder in unterschiedlichen Geschichten und Zeiten herum. Mal sind wir im 16. Jahrhundert, mal in der Gegenwart oder in der Zukunft, jedenfalls verfolgen wir eine Sammelklage, die die USA dazu verpflichtet, das Land an ihre Ureinwohner*innen abzutreten.
Oft wagt er sich in eine fast schon surrealistische Ebene, die die schwer im Magen liegende Thematik auflockert, zum Beispiel wenn die Eroberer in den tiefsten Wäldern Floridas auf den Ikea-Gründer, den Häuptling Kamprad Kamprad treffen, oder der Koch im Lager zufällig das Coca-Cola erfindet. Auch die „Me-Too“ Debatte nimmt plötzlich als „Mitú“ seinen Ursprung bei den Cofitachequi, einem matriarchal organisiertem Stamm (den es tatsächlich gegeben hat).
Manchmal baut Franzobel aktuelle politische Thematiken ein, etwa wenn der Stammeshäuptling Quigaltangi vor der Zerstörung der Erde durch die Weißen warnt. Oder wenn die Spanier beteuern, ihr Umgang mit den Indigenen müsse so hart sein, denn es brauche eine gewisse Abschreckung. Da kommt man nicht drum herum, als an die aktuelle Flüchtlingspolitik der EU zu denken.
Franzobel gelingt damit in „Die Eroberung Amerikas“ das fast unmögliche: Einerseits eine historisch extrem gut recherchierte Geschichte, andererseits gute Unterhaltung, bei der einem das Lachen aber oft im Hals stecken bleibt. Mit dieser Mischung schafft er es Fragen zu stellen, die heute von großer Bedeutung sind und macht „Die Eroberung Amerikas“ daher zu einem aufreibenden, aber lesenswerten Roman.
Publiziert am 30.01.2021