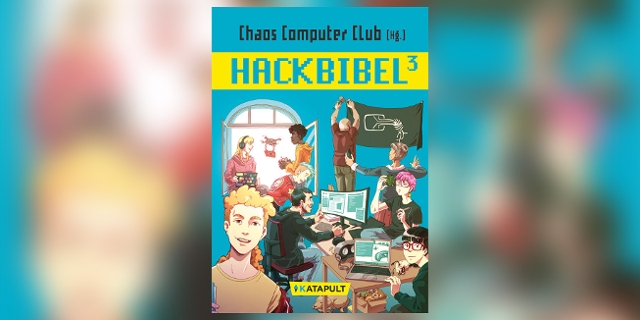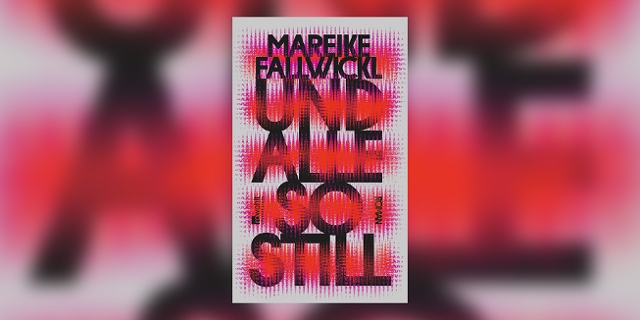Brandon Taylors Roman „Real Life“: Ihre Lösung ist schweigen
Von Lisa Schneider
Nematoden sind weiße bis durchsichtige, fadenähnliche Würmer, sehr kleine Tierchen, die vor allem auch in der Forschung eingesetzt werden. Wallace, Protagonist in Brandon Taylors Debütroman „Real Life“, studiert an einem nicht benannten College im Mittleren Westen Biochemie als Postgraduate Student. Die Erkenntnisse durch Genmutationen, die seine Nematoden länger als normal am Leben erhalten, sollen die Basis für seine Doktorarbeit bilden. Eines Tages kommt Wallace ins Labor, die Behälter mit den Würmern sind schimmeldurchzogen und somit kontaminiert. Wochen- bzw. monatelange Arbeit ist dahin. Über allem schwebt die Ahnung, dass das kein Zufall war, dass womöglich jemand von außen eingegriffen hat. Wallace ist nicht wirklich beliebt an seinem Arbeitsplatz. Auch sein Privatleben schlingert.
Der Roman „Real Life“ spielt an einem langen Wochenende im Sommer, in besagter Universitätsstadt. Es sind die letzten Tage, bevor Wallace sein viertes Jahr als Postgraduate antritt. „Real Life“ ist mit seinen etwas über 300 Seiten kein besonders umfangreicher Roman, und man erfährt über Brandon Taylors Erzählweise schon viel, nachdem man die ersten 60 Seiten gelesen hat. Wie schön verschwenderisch er mit Zeit umgeht, wenn er diese ersten Episoden dafür nützt, ein Zusammenkommen der College-Freund*innen am See detailreich zu beschreiben. Auch eine Kunstform: anhand weniger, aber intensiver Momente ein ganzes Leben zu skizzieren.
Außenseiter und Metaebenen
Wallace ist im ländlichen Alabama aufgewachsen, er ist Schwarz, schwul und „chubby, at best“. Das mühsame, am Ende unergiebige Abarbeiten im Büro und das Absterben seiner Testwürmer spiegelt sich in einem zweiten Todesfall wider. Wallace’ Vater ist vor kurzem gestorben. Er ist nicht zum Begräbnis gefahren. Auch so eine Sache, die Wallace lieber nicht mit seinen Freund*innen geteilt hätte, bis er sich schließlich doch hinreißen lässt und sich einmal mehr nicht vor ihnen erklären kann. Dass hinter seiner „seltsamen Trauer“ Gewalt und Kindesmissbrauch stecken, weiß niemand. Niemand, außer später der selbsterklärte heterosexuelle Miller, mit dem Wallace eine mitunter gewalttätige Affäre eingeht.
„Er hat wenig Erfahrung mit Freundschaft, dafür aber mit Gewalt. So, wie er das kommende Wetter spürt, kann er aus einem Stimmungsumschwung die Form der sich anbahnenden Gewalt ablesen. Dann ist er ganz in seinem Element, in seiner Muttersprache – er weiß, was Menschen sich gegenseitig antun können.“
Kleine Wörter, Gesten oder Bewegungen erinnern ihn an sein früheres Zuhause: Dunkles Wasser, das sein Vater wie alles andere gehortet hat, der Spruch „Mal nicht den Teufel an die Wand“, den die tiefreligiöse Großmutter immer wiederholt hat, das Klatschen eines hünenhaften Mitstudenten, fast so, wie sein Bruder ihn immer lautstark erschreckt hat. Armut, Alkoholismus, strengste Religiosität. „Ihm wird übel.“
Wallace leidet. Er weiß nichts mit sich anzufangen bei den ständigen Dinnerpartys mit seinen ausschließlich weißen Komiliton*innen. Er ist Mitläufer und Projektionsfläche, er ist der, an dem man Liebe, Hass, Zorn und Leidenschaft auslässt. Er spricht wenig, und wenn, dann nur „wenn jemand Mitleid bekam und ihm ein paar Brocken Small Talk vor die Füße warf.“ Neben der täglichen Diskriminierung und dem Unverständnis seiner Freund*innen kämpft Wallace mit der Überblendung von Liebe, Sex und Gewalt. Und er kämpft mit dem, was er eigentlich will vom Leben: „Real Life“ ist, neben vielem anderen, auch ein Coming-Of-Age-Roman und gerade dafür ist das Setting im akademischen Umfeld bestens geeignet.
Der Campusroman: eine fruchtbare Tradition
Gewachsene Hierarchien, Unterdrückung, Menschen, die Gewalt ausüben und an denen Gewalt ausgeübt wird. Die Universität ist einmal mehr der Ort, an dem alles versprochen, und der deshalb nicht weniger der nur vermeintlichen Progressivität entlarvt wird. Brandon Taylor schreibt in klarer, mitleidsloser Sprache über Machtstrukturen, von denen seinen Figuren schon, aber viel öfter nichts wissen. Er hat Jane Austen und Emile Zola gelesen und auf ihre Charakterzeichnungen hin studiert. Mehr als bei Austen sind es vor allem die Figuren von Zola, die ganz nach der naturalistischen Tradition unter äußeren Einflüssen stehen und nach Kräften handeln, die nur der Erzähler kennt. Man denke sich einen Ameisenhaufen, daneben ein allmächtiges Wesen mit erhobenem Stock in der Hand.
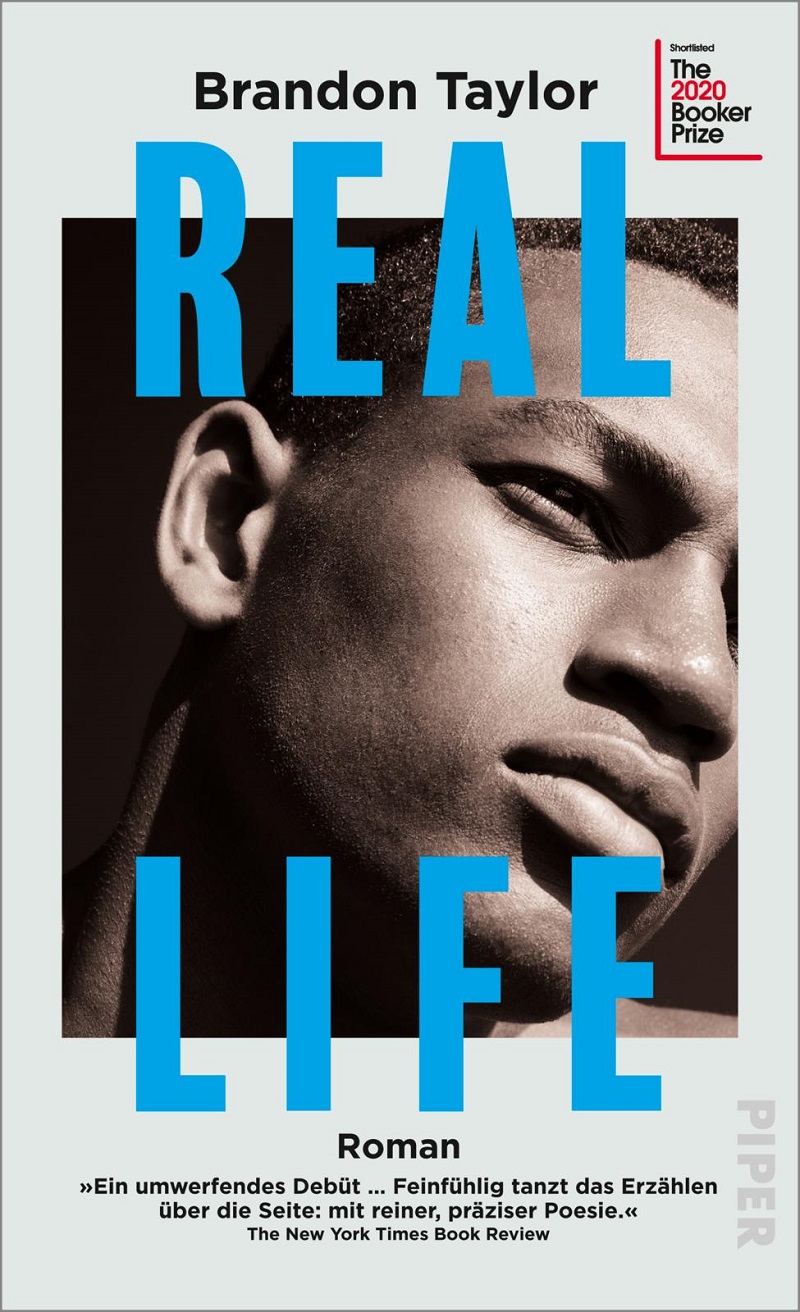
Piper
„Real Life“ von Brandon Taylor erscheint in deutscher Übersetzung von Eva Bonné im Piper Verlag.
Die eigentlichen zentralen Ort des Romans sind aber nicht die Vorlesungssäle oder die Labore, es sind die erwähnten Treffen der Freund*innen, bei denen sich das soziale Gefüge und vor allem Wallace’ Platz darin zeigt. Er erinnert sich an seine ersten Tage in der Universitätsstadt zurück, er hat schwedische Hackbällchen vorbereitet und ist am Weg zum Haus eines Freundes. An der Tür öffnet ihm eine junge Frau, sie sieht ihn verdattert an und fragt, ob er sich verlaufen hätte (zusätzlich dazu war Fleisch in Wallace’ entbehrungsvoller Kindheit ein Festmahl; seine neuen, wohlsituierten Freunde sind natürlich Vegetarier, ein Wohlstandsphänomen). Im Drugstore - er will „nur Seife und Deo kaufen“ - wird er von einem weißen Verbindungsstudenten als Drogendealer bezichtigt.
Bei einem weiteren Abendessen spricht Wallace seine Überlegungen, die Uni zu verlassen, laut aus („Eigentlich wollte er die Universität nicht verlassen, sondern sein Leben“). Roman, ein französischer Student, antwortet: „Aber sie haben dich hier trotz deiner Defizite genommen.“ Es gäbe keine Aussichten für jemanden wie ihn, ohne Collegeabschluss, ohne Doktortitel. Am Tisch wird es still.
„Niemand sagt etwas. So ist das immer. Ihre Lösung heißt schweigen, denn wenn sie lange genug schweigen, wird dieser kleine, unbehagliche Moment verstreichen und sich in die Topographie des Abends einfügen, als wäre nichts gewesen.“
„Manchmal wäre ich gern da draußen“
Wallace bleibt stumm. Er ist nicht da, im Mittleren Westen, um rassistische, universitäre Strukturen aufzubrechen. Oder um sich gegen seine Vorgesetzte zu wehren, die lieber immer seine Kollegin Dana in Schutz nimmt, wenn sie Wallace vorwirft: „Du bildest dir wohl ein, du könntest dir alles erlauben, bloß weil du schwul und schwarz bist und so tust, als könntest du keine Fehler machen.“ Im Gegenteil. Wallace kämpft sich irgendwie durch, er versucht, ohne größtmögliche physische und psychische Schäden die Uni abzuschließen: „Er arbeitet nur, damit die Menschen ihn nicht hassen und ihm einen Platz in der Welt einräumen. Er arbeitet, um mit dem, was er mitbringt, irgendwie zurechtzukommen.“
Er wollte keinen „preachy tone“ anschlagen, sagt Brandon Taylor, und das zeichnet den Roman auch besonders aus. „My job as a novelist is not to insulate the reader from the discomfort of the world, it is my job to reveal it and hope something comes out from that exchange.“
Der Campus ist ein soziales Biotop. Da wird gesucht, probiert, gescheitert. Für die meisten das erste Mal weit weg von zuhause, mit dem Geruch von Erwachsensein in der Nase. Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion und Kontostand kommen hier zusammen. Ein besseres literarisches Setting für zwischenmenschliche Studien gibt es kaum, mehr Drama geht nicht. Und auch deshalb ist die Tradition des Campus-Romans eine lange und facettenreiche. Tom Wolfe („I Am Charlotte Simmons“) etwa erzählt aus der Perspektive einer Studentin, J.M. Coetzee („Disgrace“) oder Philip Roth („The Human Stain“) aus Sicht des Lehrkörpers. Die Essenz des Campusromans findet man vielleicht aber am ehesten in diesem Zitat: „Lust and learning. That’s really all there is, isn’t it?“, schreibt John Williams in seinem Roman „Stoner“, die junge Studentin sagt’s zum gealterten Professor. All das hat Brandon Taylor gern gelesen, nur, sagt er, hat er sich nie selbst repräsentiert gefühlt. Auch deshalb hat er „Real Life“ geschrieben.
Bevor er sein Leben dem Schreiben gewidmet hat, hat Brandon Taylor selbst Biochemie studiert und fast zehn Jahre seines Lebens an diversen Universitäten verbracht. Er ist ein ganz offenbar sehr schlagfertiger und auch sehr lustiger Interviewpartner, der auch lachen muss, wenn er nach den Parallelen zwischen dem Roman und seinen eigenen Erfahrungen mit der akademischen Welt gefragt wird. „Wallace is an amalgam of Taylor’s own experiences as well as those of other queer black people on college campuses“ verrät er der New York Times im Interview.
Publiziert am 02.05.2021