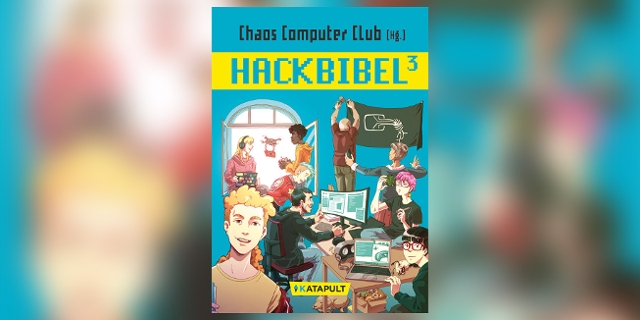Rosalía kennt auf „Motomami“ keine Kompromisse
Von Melissa Erhardt
Irgendwann in den vergangenen drei Jahren muss es passiert sein: Rosalía hat sich von der in Tablaos auftretenden Flamencosängerin aus dem Norden Kataloniens in dieses unfassbar brillierende Sternchen am internationalen Pophimmel verwandelt. Eingekleidet in Versace und Fendi trank sie auf einmal Mimosas mit Kylie Jenner, jettete mit Boyfriend und Latino-Popstar Rauw Alejandro im Privatjet um die Welt und begann mit Nike als erste Künstlerin im hispanischen Raum an eigenen Sneaker zu werkeln. Dazwischen droppte sie immer wieder mal ein Feature, stets mit den größten und wichtigsten Namen der zeitgenössischen Popindustrie, stets gingen diese durch die Decke.
Für den Menschen hinter dem Popstar blieb in all diesen Jahren nur wenig Zeit. Und so kommt „Motomami“ ins Spiel, Rosalías drittes Studioalbum. Es ist ein intimes und kraftvolles Selbstporträt einer Musikerin, die den Pop durch ihr bewusstes Missachten von Grenzen in eine neue Sphäre katapultiert.
Der Schmetterling - La Mariposa
Bevor es aber zum Inhalt geht, müssen wir natürlich über den Sound sprechen. „Yo soy muy mía, yo me transformo / Una mariposa, yo me transformo” setzt die 29-jährige Spanierin zur Hook auf “Saoko” an - dem letzten Song, den sie für ihr Album aufgenommen hat und der erste, der als Single erscheinen sollte. Anfang Februar deutete sie damit schon an, wohin die Reise auf „Motomami“ gehen sollte: Ein nackter, herunter gewerkelter Dembow-Beat aus der Anfangsära des Reggaetons trifft hier auf einen gewaltige Bass-Linie, so als ob gleich eine unausweichliche Gefahr über uns hinweg rollen würde – im Video übrigens sehr schön visualisiert mit einer weiblichen Gang an Motomamis, Frauen auf fetten Maschinen, having the time of their life. Unterbrochen wird diese düstere Stimmung in der Mitte des Songs von einem lieblichen Jazz-Piano-Solo, das uns aus der brenzligen Situation zu befreien scheint, bevor der Track mit einem gewaltigen Crescendo zu Ende geht und uns wie angewurzelt zurücklässt.
Kontraste übertrumpfen sich hier mit Kontrasten, im Mittelpunkt steht die Transformation, visualisiert durch den Schmetterling, der Mariposa, die als Sinnbild für das gesamte Werk fungiert. „Ich widerspreche mir selbst, ich verwandle mich / Ich bin alle Dinge gleichzeitig“ sagt eine verzerrte Rosalía und läutet damit das Kredo für die nächste knappe Stunde ein. Reggaeton soll auf „Motomami“ auf Jazz treffen, die rhythmischen Palmas des Flamencos auf scheppernde Industriebeats, kubanischer Bolero auf Hip-Hop der 2000er. Zusammen mit Produzenten wie Noah Goldstein, El Guincho, Pharell Williams, Michael Uzowuru oder Tainy wird hier experimentiert, dekonstruiert und auseinandergenommen, um Neues zu schaffen. Sounds, die wir so selten gehört haben. „I feel like music from different places keeps me thinking, it keeps me reflecting, it keeps me inspired”, erzählt sie im Album-Interview mit Apple’s Zane Lowe: “That’s why I always try to ask myself: How can I make this work with this? Then you always get something different. Sampling exists like forever, nowadays it’s just more obvious”.
Dekonstruierte Club-Tracks wie “CUUUUuuuuuute“, die mit wummernden Percussions hemmungslos nach vorne ziehen und dabei an Arca oder FKA Twigs erinnern finden wir auf „Motomami“ deshalb genauso wie Latin Herzschmerz Balladen á la „Candy“, auf dem sie Burials ikonischen Track „Archangel“ mit einer Hommage an Plan B’s „Candy“ verschmelzen lässt, einem Klassiker der neueren Reggaeton-Geschichte. Auf „Chicken Teriyaki“ und „Bizcochito“ gibt sie sich verspielt und humorvoll wie noch nie, stets untermalt von einem klassischen Dembow, dem „Leitbeat“ des Reggaeton. Sakrale Orgeltöne, harmonische Synthies, dezenten Autotune und weiche Pianos – der Fantasie sind bei Rosalía keine Grenzen gesetzt.
Darf sie das?
Jede Menge Bewunderung brachte ihr seit ihrem Durchbruch diese Herangehensweise an ihre Musik ein, aber auch große Kritik und starke Ressentiments – oder, wie man mit einem kurzen Blick auf Twitter sagen könnte: The Rosalía discourse was always loud.
„Kulturelle Aneignung“ wurde häufig in den Raum geworfen, wenn es um Rosalía ging: Zunächst war es der Flamenco, dann der Reggaeton, dann Bachata, an denen sie sich bediente und mit denen sie die Charts toppte. Was all diese Genres gemeinsam haben, ist ihr Ursprung in gesellschaftlich marginalisierten Gruppen. Musik ist hier oft weitaus mehr als Unterhaltung, es ist eine zutiefst politische Form der Auseinandersetzung mit den eigenen Kämpfen: Ob der der vertriebenen Roma im Flamenco oder der der BPOC im Reggaeton. Dass diese Musikrichtungen oft erst dann internationale Anerkennung erlangen, wenn sie von weißen Musiker*innen performt werden, tut sein Übriges. Ein gewisser Groll in den Communities ist also mehr als verständlich.
Rosalía ging mit dieser Thematik bisher sehr vorsichtig um. In Interviews legte sie ihr Verständnis von Genres immer wieder offen: Für sie seien diese „unvollendete Konstrukte“, die konstant weiterentwickelt werden sollten - natürlich unter der Wahrung ihrer Geschichte und den bestimmten „Codes“, die sie vermittelten. Respektlosigkeit kann man ihr in ihrer Herangehensweise nicht vorwerfen. Auch auf „Motomami“ macht sie das noch einmal deutlich, etwa auf „Bulerías“ dem einzigen Flamenco-Track des Albums. Es ist eine Art Hommage an die großen Ikonen ihrer Musikwelt, an diejenigen, die sie inspiriert haben und als dessen Ergebnis sie sich selbst betrachtet. Flamenco-Musiker*innen wie Caracól, Nina Pastori oder José Mercé zählt sie hier genauso auf wie Tego Calderón, ein Schwarzer Wegbereiter des Reggaetons, M.I.A. oder Lil Kim.
Auch sonst strotzt das Album nur so an Querverweisen an die lateinamerikanische Musikwelt: Der eben schon erwähnte Track „Candy“ zum Beispiel, oder die Single „Saoko“, eine Wertschätzung auf Daddy Yankees und Wisins „Saoco“ aus dem Jahr 2004 - einer Zeit, als Reggaeton gerade seine erste Blütezeit erlebte. Aber auch ihre besondere Vorliebe für dominikanischen Dembow macht sie auf „Motomami“ einmal mehr deutlich – und zwar nicht nur durch ein zweites Feature mit der dominikanischen Musikerin Tokischa („La Combi Versace“), sondern etwa auch mit den Zeilen „¿Qué más da que me tire La Mala? / Si Haraca me tira la buena“, mit denen sie sagen möchte: Ihr ist es wichtiger, was Haraca Kiko, ein dominikanischer Musiker, von ihr hält, als das, was die spanische Rapperin Mala Rodriguez über sie denkt. Bezeichnend.
Das Einzige, das zumindest für mich fragwürdig bleibt, ist, warum sie sich für „La Fama“ nicht gleich mit Bachata-Gott und Rosalía-Fan der ersten Stunde, Romeo Santos (Aventura), zusammengetan hat und sich stattdessen für eine – sorry an alle Fans – billige Kopie durch The Weeknd entschieden hat. Das bleibt uns wohl ein Rätsel.
Die Kirschbaumblüte - La Flor de Sakura
Kommen wir aber zurück an den Anfang – und zwar zu dem Menschen hinter dem Popstar. Denn schieben wir das gesamte Soundbild beiseite und arbeiten uns langsam zur Essenz des Albums vor, zum Konzept, das sie dabei verfolgt hat, dann stoßen wir dort auf ein intimes Selbstporträt der 29-jährigen Musikerin. Damit hebt sich „Motomami“ stark von seinen Vorgängern ab: Ihr letztes Werk, „El Mal Querer“, war immerhin eine musikalische Aufarbeitung einer okzitanischen Liebesgeschichte aus dem 13. Jahrhundert, ihr Debüt „Los Ángeles“ ein reines Flamenco-Album über den Tod.
Auf „Motomami“ wird Rosalía hingegen deutlich wie noch nie: Sie spricht über ihr Heimweh nach Spanien, reflektiert und kommentiert ihren bisherigen Weg und die Kritik, die sie öfters einstecken musste (etwa auf Bizcochito in frechen Ton: „Meine Karriere basiert nicht darauf, dass ich Hits habe - ich habe Hits, weil ich die Grundlagen dafür geschaffen habe“.) und findet in ihrem Verlangen nach körperlicher Zuneigung und unerwiderter Liebe eine ungeahnte Friedfertigkeit.
Eines der zentralen Themen des Albums ist aber der bittersüße Nachgeschmack des Erfolgs und das vergängliche Popstar-Dasein - symbolisiert durch die Kirschbaumblüte, die „Flor de Sakura“. In der japanischen Kultur (mit der Rosalía auf „Motomami“ ebenso spielt) steht diese für den Wert, den das Leben erst durch seine Vergänglichkeit bekommt: Die Blüte ist wunderschön - aber eben nur für kurze Zeit, ehe sie wieder verwelkt. Und so singt Rosalía auf dem Closingtrack „Sakura“ mit einer unglaublichen Vorsicht: „Flor de Sakura / Ser una Popstar nunca te dura / Flor de Sakura / No me da pena, me da ternura“. Also: Kirschbaumblüte / Ein Popstar zu sein hält nie an / Kirschbaumblüte / Das verursacht bei mir kein Mitleid, sondern nur Zärtlichkeit.
Rosalía will sich von diesem vorbeigehenden Zustand nicht hypnotisieren lassen – oder wie sie auf „La Fama“ singt: „Der Ruhm ist ein übler Liebhaber. Vielleicht werde ich mit ihm schlafen, aber ich werde ihn niemals heiraten“. Diesen Gedanken vertieft sie auch auf dem Track „G3 N15“ (Genís) nochmal: Geschrieben als Brief an ihren 10-jährigen Neffen lässt sie hier eher harsche Zeilen über L.A. und Hollywood liegen: „Hier, zwischen Sternchen und Spritzen, ist niemand in Frieden“.
Dass dieser inhaltliche Aspekt vielen Hörer*innen aufgrund der sprachlichen Barriere verborgen bleiben wird, bereitet mir jetzt schon etwas Herzschmerz. Aber alles andere – der Sound, die Kontraste, das Verspielte und das Harte, die Visuals, diese Welt, die Rosalía erschafft – die ist universell verständlich. Und das ist das Schöne daran.
Publiziert am 21.03.2022