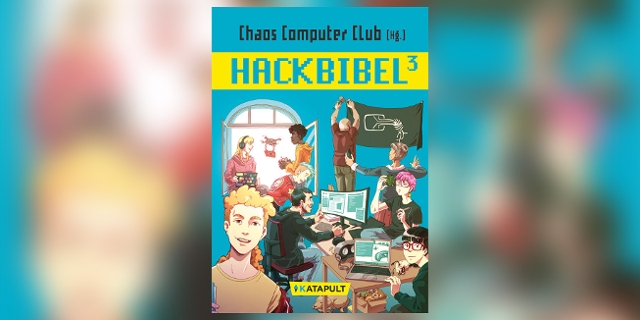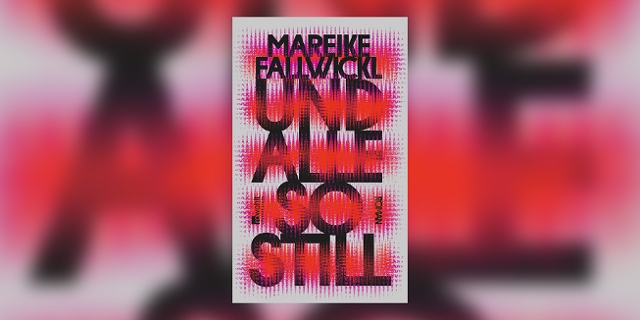War früher wirklich alles besser, Ana Iris Simón?
Von Melissa Erhardt
„Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem Alter." So beginnt Ana Iris Simón ihren autobiografischen Roman „Mitten im Sommer“. Immerhin hätten die in ihrem Alter schon ein siebenjähriges Kind und ein Reihenhaus in der Provinz gehabt - sie selbst hingegen hat nur ein iPhone, ein Ikearegal für dreißig Euro und drei verschiedene Streaming-Abos.

Hoffmann und Campe
„Mitten im Sommer“ von Ana Iris Simón ist in der Übersetzung von Svenja Becker im Hoffmann und Campe Verlag erschienen.
Die Melancholie nach alten Zeiten, dieses „Früher war alles besser“ kennen wir gut, meistens aber aus einer traditionelleren, konservativeren Perspektive. Ana Iris Simón hingegen wächst mit dem Kommunismus auf, ihr Uropa ist sogar im französischen Exil gestorben, weil er Kommunist war. Ihre Eltern sind einfache Postler, die Großeltern Bauern und Marktleute. Simón weiß Bescheid über Klassenverhältnisse, hat sogar ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür. Vom Liberalismus aber, vom Glauben daran, dass wir uns von unseren gesellschaftlichen Zwängen und Fesseln befreit hätten und jetzt frei sind – von dem hält sie nichts. Obwohl sie es ja probiert hat, das freie, losgelöste Studentenleben in Madrid:
„Ich war es doch, die sich entschieden hatte, in einem Themenpark zu wohnen, die geglaubt hatte, wenn ich mit Anfang zwanzig in dem arbeitete, was meine Leidenschaft ist, dann wäre das schon ein Erfolg, und sei es für 1000 Euro und kaum abgesichert. Ich hatte doch gedacht, nur arme Leute würden jung Kinder bekommen, so wie meine Eltern, und es mit unter dreißig nicht mal in Erwägung zu ziehen wäre ein Zeichen dafür, dass etwas vorangeht, wo es genau umgekehrt ist.“
Die tatsächlich verlorene Generation
Dass Ana Iris Simón so denkt, wie sie denkt, kommt nicht von irgendwoher. Die 32-jährige ist Teil jener spanischen Generation, die nicht nur die Finanzkrise 2008 hart zu spüren bekommen hat - auch die Corona Pandemie hat ihr noch einmal einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Dass diese Krisen Lebensrealitäten prägen, ist klar - dass sie auch die Literatur prägen, wird gerade auf der Frankfurter Buchmesse deutlich, bei der Spanien heuer Gastland ist. Bei Simón haben die Krisen dazu geführt, dass sie ihre Anstellung als Drehbuchautorin beim spanischen Fernsehen gleich dreimal verloren hat: Massenentlassungen eben.
Kein Wunder also, dass sie fast schon romantisierend auf ihre Kindheit und das Leben ihrer Eltern zurückschaut, vom Familienleben und der Dorfgemeinschaft erzählt, die eben auch das feministische Care-Kollektiv in Madrid nicht ersetzen kann. Im Gegenteil: Wenn ihre Großmutter und Tante wüssten, dass das, was sie schon ihr Leben lang taten – nämlich gemeinsam spazieren zu gehen – in der Hauptstadt als „Knüpfen von Netzen weiblicher Fürsorge“ bezeichnet werden würde, würden sie lachen.
Ana Iris Simón wurde 1991 geboren. Sie studierte audiovisuelle Kommunikation an der Universität Rey Juan Carlos südlich von Madrid. Danach faltete sie T-Shirts und jobbte als Sicherheitsbeamte bei der Telefónica de la Gran Vía. Sie arbeitete als Redakteurin bei Vice und als Drehbuchautorin bei der RTVE und verlor drei Mal ihre Anstellung aufgrund von betrieblichen Massenentlassungen. Heute lebt sie mit ihrem Partner und ihrem Sohn in einer Provinzstadt.
In einem Interview mit El País, der spanischen Tageszeitung, für die Simón eine wöchentliche Kolumne schreibt, erzählt sie, sie habe im Buch nicht unbedingt über ihre eigenen Fehler gesprochen, sondern über die einer ganzen Generation, der man immer wieder gesagt hätte: Wenn ihr in euren Dörfern bleibt, seid ihr Hinterwäldler. „Man hat uns gesagt, dass wir in die Stadt müssen, dass unser Leben nichts wert wär, wenn wir nicht auf die Uni gehen würden und tausend Stempel in unseren Reisepässen hätten. Irgendwann kommt dann aber der Punkt, so wie bei mir mit 30 Jahren, wo man sich dann denkt: Was zum Teufel mach ich hier eigentlich?“.
„Mitten im Sommer“ ist erfrischend, weil Ana Iris Simón ehrlich und scharf analysiert und dabei gerne auch aneckt. Zwischendurch wird sie vielleicht eine Spur zu zynisch, etwa wenn es um Männlichkeitsideale geht und Simón behauptet, die Indies der Nullerjahre wären „als Väter für unsere Kinder ein Totalausfall“. Hinter der Kritik am gescheiterten Aufstiegsversprechen und ihrem Aufbrechen liberaler Fassaden versteckt sich aber vor allem eins: Ein Plädoyer für mehr Community und mehr Familie - und weniger individualistisches Einsiedlertum.
Publiziert am 18.10.2022