Das Buch „Das Pi der Piratin“: eine gescheiterte Revolution der Sprache
Von Alica Ouschan
Wir leben in einer großteils männlich geprägten Sprachwelt. Sobald eine Frau über Sexualität, Wollust und Begierde spricht, hat sie keine andere Wahl, als sich eines männlich geprägten Vokabulars zu bedienen. Eine weibliche Sprache für Lust? Gibt es nicht.
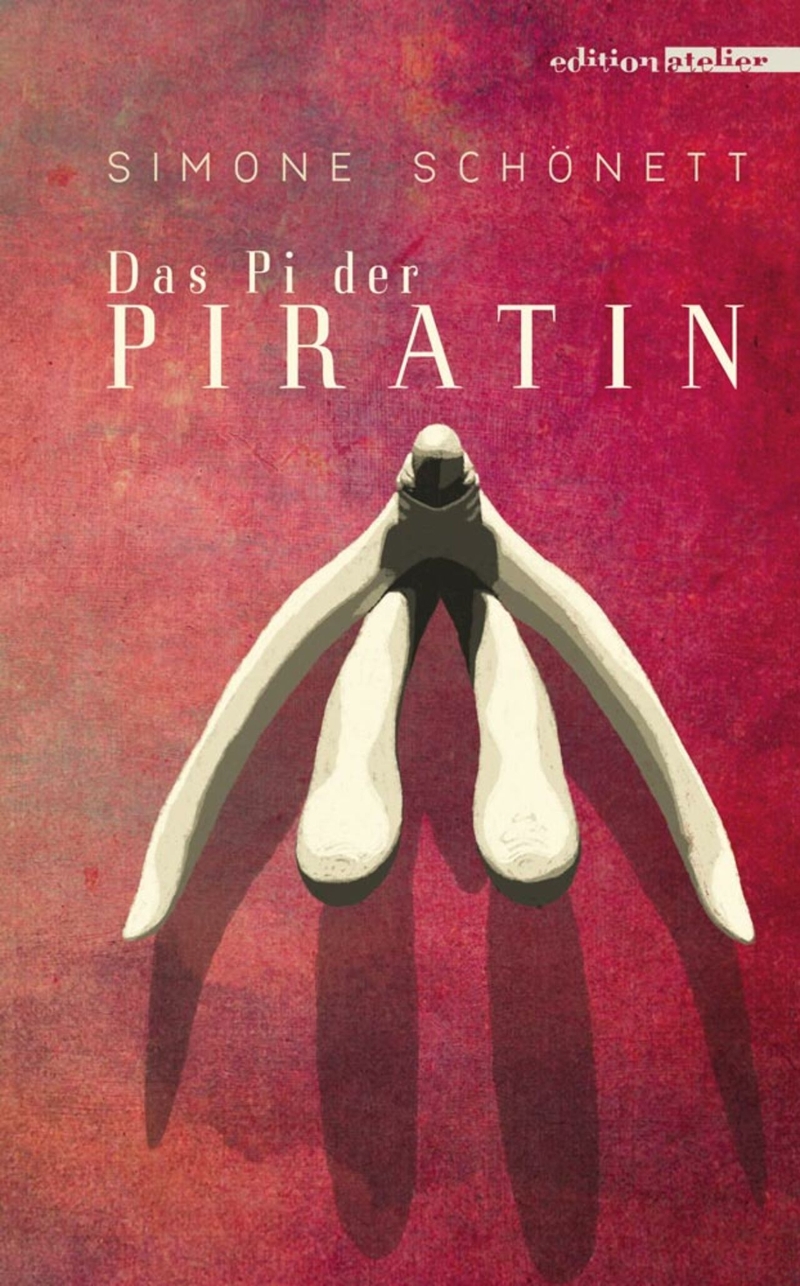
edition atelier
Das Pi der Piratin von Simone Schönett hat 104 Seiten und ist im edition atelier Verlag erschienen.
Das ist der Anstoß für die Autorin Simone Schönett „Das Pi der Piratin“ zu schreiben. Sie führt uns in ihrer Prosa mit markantem, aufbauschenden Stil durch eine Aneinanderreihung von vagen Umschreibungen, wirren Vergleichen und banalen Metaphern, auf der Suche nach Worten, die unauffindbar scheinen.
„Ich hatte Sehnsucht nach dem passenden Sprachkleid gehabt, doch unterschätzt, wie weit ich für diesen Stoff meine Beine breit machen musste, breiter, als es mir letztlich lieb war. Ich war zum Spreizen bereit, doch würde ich mir auch unter die Haut schauen lassen?“
Bekannte Symbole und wirre Vergleiche
Das lyrische Ich scheint sich im Kreis zu drehen und hüpft von einem Vergleich zum nächsten. Dabei bewegt sich das Spektrum zwischen unerwarteten, teilweise sehr unpassend erscheinenden Symbolen bis zu bereits hundertmal gehörten, bekannten Begriffen und Umschreibungen: Vom Nähkästchen, zur Büchse der Pandora über die Seerose bis hin zur bezahnten Vulva. Anstatt sich diese jedoch zu eigen zu machen, neu zu konnotieren oder sich klar dagegen zu stellen, gleichen die Ausführungen oft mehr einer wirren Aufzählung als einer Auseinandersetzung mit deren Verwendung oder Bedeutung.
Simone Schönett bedient sich an Beispielen aus dem Tierreich, an Sagen und der Pflanzenwelt – vor allem an den (leider viel zu naheliegenden) Blumen und Knospen. Sie bemerkt wieder und wieder, dass ihr die Worte fehlen, um das auszudrücken, was sie eigentlich sagen will. Sie verfängt sich ständig in bereits bekannten Begriffen und bauscht sie immer wieder neu auf, ohne wirklichen Sinn darin zu finden. Auch schwierige Begriffe wie „Schamlippen“ - ein Wort, das stark in den Köpfen der Menschen verankert ist und unvermeidbar Scham mit dem weiblichen Geschlecht konnotiert - wird teilweise unreflektiert verwendet, statt abgelehnt.
In ihren Ausführungen, die sich ständig zu wiederholen scheinen, bleibt sie oft so unkonkret, dass man nur erahnen kann, worauf sie damit eigentlich hinaus will. Ein Satz spannt sich gut und gern mal über zehn Zeilen. Das Herumwerfen von kreativ ausgewählten Adjektiven und neu zusammengestellten Wortkombinationen, um fast schon zwanghaft eine möglichst bildhafte Sprache zu erzeugen, zeichnet zwar den unverkennbaren Schreibstil aus, erschwert jedoch die Lesbarkeit und wirkt eher seltsam als literarisch wertvoll.
„Wieder kam ich vor Zäunen zu stehen, dabei hatte ich über die Grenzen gehen wollen. Im Niederreißen der eigenen Schamwände gelangte ich in Gärten und Knospen und vergrub all diese Metaphern sogleich im Gemüsebeet, fing an, neue hervorzuholen, aus der Erdscholle, mit der Spitzharke, mit dem Spaten, schuf dabei aber nur, maulwurfgleich, blindlings Verbindungsgänge, wo alles schwieg.“
Ein gescheiterter Versuch
Anstatt des zu erwartenden Kampfs gegen etablierte, herabwürdigende Begriffe und des erhofften Ausbrechens aus der Sprachwelt, in der nichts auch nur annährend das auszudrücken scheint, was die Autorin eigentlich sagen will, wirkt es beinahe so, als hätte sie ihren Kampf bereits aufgegeben, bevor sie ihn überhaupt so richtig aufnimmt.
Interessant bleibt natürlich die Frage, ob das nun bedeutet, dass es so etwas wie eine Revolution der Sprache überhaupt nicht geben kann - zumindest nicht mit den vorhandenen Sprachwerkzeugen - und was es braucht, um die Sehnsucht nach einer weiblichen Sprache der Lust erfüllen zu können.
Natürlich kann das lyrische Ich in Simone Schönetts Prosa sich nur der Sprache bedienen, die sie vorfindet, um die Wirklichkeit zu kreieren, die sie sich wünscht. Bestehende Muster werden nicht aufgebrochen, sondern nur auf alle möglichen Arten wieder miteinander verwoben - ohne dabei etwas Neues zu erschaffen. Simone Schönett hat mit ihrer Prosa aber den Anspruch erhoben, die weibliche Sprache lustvoll zu revolutionieren und damit die Erwartungen extrem hoch geschraubt.
Standhalten kann sie ihnen schlichtweg nicht. „Das Pi der Piratin“ ist der innere Monolog einer Frau, die drüber nachdenkt, wie sich weibliche Lust sprachlich ausdrücken könnte. Sie dreht sich im Kreis und kommt nicht zum Höhepunkt. Am Ende bleibt die unbeantwortete Frage, welchen Zweck das Ganze eigentlich hatte und ein unangenehm hoher Grad an Unbefriedigung.
Simone Schönetts Prosa hält nicht, was sie verspricht – es ist keine lustvolle Revolution der weiblichen Sprache, sondern ein Versuch, aus bestehenden Wortwerkzeugen eine neue Sprachwelt zu zimmern, der ihr nicht so recht gelingen will.




















