Die Geistertöne in unseren Köpfen
Von Robert Rotifer
Ich geh ja grundsätzlich nicht zu Stadion-Gigs.
Mein bisher einziger Near-miss mit einem Stadionkonzert ereignete sich im Jahr 1987, als ich eine halbe Stunde lang vor dem Praterstadion in Wien herumhing, während drinnen die Glass Spider-Show von David Bowie ablief. Ich war damals mit 17 ein größerer Snob als heute, Stadionrock der Feind, und die Ankündigung im Vorfeld, dass Bowie auf einem silbernen Stuhl vom Dach der Bühne abgeseilt werden würde, stand in Einklang mit der schwerfällig leblosen Musik, die aus der Betonschüssel nach außen drang. Klinisch präzise gespielt, wohl der schwierigen Akustik bzw. der größtmöglichen Klarheit trotz Hall und Widerhall zuliebe.
So, dachte ich seither, gehen eben Stadiongigs. Gut für Leute, die das mögen, für mich mehr was zum Meiden.
Korrektur, sagt das morsche Gedächtnis: Technisch gesehen war ich noch bei einem anderen Stadionkonzert, nämlich 1994 in Wiener Neustadt, um dort Paul Weller in abgeschnittenen Jeans als Support von Herbert Grönemeyer spielen zu sehen („technisch gesehen“, weil jenes „Stadion“ schon eher einfach ein Fußballplatz war).
Grönemeyer kam damals vor Wellers Auftritt auf die Bühne gelaufen, um das niederösterreichische Publikum zu informieren, dass dieser „Polwellah“ eine „Legendöh“ sei, die unsere Aufmerksamkeit verdiene. Ich gehörte zu dem kleinen Häufchen an der Mittelauflage, das nur wegen Weller gekommen war, nicht ahnend, dass ich knapp drei Jahrzehnte später den selben Mann vor einer anderen Band in einem Stadion spielen sehen würde. Gestern nämlich in Wembley im Vorprogramm von Blur.
Da hatte ich also meinen Grundsatz gebrochen.
Ganz ehrlich: Als Blur letzten Winter aus dem Blauen einer siebenjährigen Schaffenspause heraus erst ein, dann zwei Wembley-Konzerte ankündigten, hatte sich das zuerst wie ein großer Fehler angefühlt. Überall auf meinen Timelines Beschwerden wegen der hohen Ticketpreise (ab 100 Pfund, für heutige Verhältnisse beinahe schon normal, und immerhin nicht „dynamisch“, aber was ein heutiger großer Pop-Act oder eine gestrige Boomer-Band darf, ist einer aus dem Nineties-Indie-Universum kommenden Band nicht ganz so erlaubt, da kommen plötzlich die damaligen Prinzipien wieder hoch).
Dazu kam die Sorge, dass Blur sich hier etwas übernommen haben könnten: Zweimal 90.000 Tickets, das ist dann doch eine ziemlich steile Vorlage. Nebenher noch der zugegebenermaßen ziemlich bequeme und selbstzufriedene Gedanke, dass ich Blur ja eigentlich schon oft genug gesehen hatte, als sie noch jung und frisch waren. Und auch danach beim großen Comeback im Hyde Park 2009, hier der Link zu meinem enthusiastischen Bericht auf unserer damals noch grauen FM4-Seite. Solche Eindrücke willst du dir nicht verderben.
Dann aber witterte ich doch einen wachsenden Buzz um diese Konzerte, nicht zuletzt in der Generation unserer Kinder, die all das versäumt hatten und selbst schon längst keine Kinder mehr sind.
Und irgendwann gegen Mitte vergangener Woche, knapp bevor es zu spät war, wurde mir schließlich klar, dass ich in Wahrheit doch auch selbst dabei sein wollte, wenn jene Längst-nicht-mehr-Kinder zum ersten Mal diese Band sehen, die weiten Teilen ihrer Generation (spreche hier von Großbritannien) soviel bedeutet.
Und zwar nicht obwohl, sondern gerade weil die Welt, die ihre Songs beschreiben, nicht mehr die heutige ist.
Das wurde mir spätestens bewusst, als die Zwanzigjährige neben mir Zeilen wie „She’s a twentieth century girl“ oder „We kiss with dry lips, then we say good night / End of a century / Oh, it’s nothing special“ aus voller Kehle sang. Das hatte was zutiefst Bittersüßes an sich, das an diesem gestrigen, entgegen allen Unkenrufen alles andere als zynischen Abend lauter sang, kreischte und klatschte als die Nostalgie meiner Altersgruppe der zu Britpop-Zeiten Dagewesenen.
Blur bzw. wer immer sich die Dramaturgie der beiden Wembley-Nächte ausdachte, trugen dieser Generationenvermischung Rechnung, indem sie den Samstagabend ein bisschen mehr jugendlich, mit den fabelhaften Jockstrap, Self-Esteem und Sleaford Mods, den Sonntagabend dagegen Mum & Dad-freundlich mit dem historischen Two Tone-Act The Selecter und eben Paul Weller als Vorbands anlegten.
Von vorletzteren bekam ich leider nur aus der Schlange vor dem Eingang die letzten Töne von „On my Radio“ aus dem Mund der großen Pauline Black mit.
Well today was a gas! Hello Wembley Stadium! Probably won’t get to say that again! So thanks for the ride! https://t.co/H9qzoZgwSG
— The Selecter(2-Tone) (@TheSelecter) 9. Juli 2023
Letzteren hörte ich dagegen in der Sommerfrühabendssonne mit einer gelungen runderneuerten Backing Band unter anderem fabelhafte Versionen von Style Council-Klassikern wie „Shout to the Top“ oder „My Ever Changing Moods“ spielen. Im knallroten Top so wie einst 1984 am selben Ort als zweiter Act bei Live Aid (ein sicher nicht zufälliger Eigen-Tribute), diesmal mit schlohweißem Haar aber weniger Verbissenheit und dementsprechend mehr Soul als vor 39 Jahren.

Robert Rotifer
An den Style Council- und Solo-Nummern freuten sich dabei sichtlich vor allem die mit ausladendem „Ich weiß, wo die Bläsereinsätze kommen!“-Gefuchtel prahlenden Dads. Noch wesentlich ältere Jam-Songs wie „That’s Entertainment“ oder „Start!“ brachten dagegen das gesamte, sich füllende Stadionrund zum Mitsingen. Interessant, wie diese Dinge funktionieren.
Jene gealterten Mods, die sich auf diversen Message Boards beschwert hatten, dass Weller als Vorband von Blur eine untragbare Erniedrigung bedeute, blieben halt zuhause. Sie haben da was sehr Schönes versäumt, das sie auf Wellers eigenen Gigs so nicht erleben werden. Ich für meinen Teil musste an seine Show damals vor Grönemeyer denken und kam zu dem Schluss, dass Weller offenbar einfach a good sport ist. Was natürlich für ihn spricht.
Außerdem gab er mir Gelegenheit, mich daran zu gewöhnen, so einen Gig aus der Position einer der (relativ) oberen Tribünen am entgegengesetzten Ende des Stadions zu erleben. Und nein, es stimmt natürlich nicht, dass man von dort aus bloß die Bilder auf den großen Screens mitkriegt, die einem die Bühnen-Action immer eine gefühlte halbe Sekunde vor Ankunft des (erstaunlich lauten und ziemlich räudigen) Sounds vermitteln. Was man aus dieser Perspektive am meisten genießt, ist vielmehr der doch sehr überwältigende Ausblick auf die vom Geschehen auf der fernen Bühne gleichermaßen erzeugten wie reflektierten Schwarm-Emotionen des Menschenmeers.
Dabei hilft, dass Blur als Headliner keinerlei Anstalten machen, die Massendompteurs-Gesten routinierter Stadion-Acts nachzustellen. Ihr Act, der keiner ist, besteht vielmehr darin, uns ganz offen spüren zu lassen, dass diese Konzerte für sie was mindestens genauso Ergreifendes sind wie für ihr Publikum.
Wenn etwa ein sichtlich überwältigter Damon Albarn das Intro von „To The End“ unterbricht, auf Graham Coxon zeigt und uns, dem Publikum erklärt: „Ihr müsst euch das vorstellen, wir zwei waren miteinander in der Schule, da war ich dreizehn, er war zwölf, und wir haben zusammen Musik gemacht. Und jetzt sind wir hier.“ Wenn Graham Damon einen spontanen Kuss auf die Wange gibt. Wenn nachher Damon zu Alex geht und ihm ebenfalls einen Kuss gibt. Wenn 90.000 Menschen dazu jeweils „Aaaaah“ machen, so als wären wir bei einer riesigen Hochzeit. Wenn Graham sich nach dem etwas lauteren „Aaaaah“ zum zweiten Kuss bei uns beschwert: „Warum bekommt das eine größere Reaktion als bei mir?“
Durch Blurs zweistündiges Set zieht sich diese Mischung aus anti-arroganter, launiger Vertrautheit und glaubhafter, blanker Emotionalität. Einmal bricht Damon zwischen zwei Songs gar in Tränen aus und zieht sich kurz in den Bühnenhintergrund zurück. Eine Kamera folgt ihm, die Screens zeigen ihn überlebensgroß als schluchzendes Häufchen. „Aaaaaaah!“

Robert Rotifer
Er mag das erfolgreich kalkulierende Kuratoren-Hirn hinter dem auch schon bald ein Vierteljahrhundert laufenden, dauerkontemporären Pop-Vehikel Gorillaz sein, aber hier, in dieser Rolle, steht Albarn quasi nackt vor uns als ein Mann mit Geschichte, das heißt, mit Brillen, bartstoppeligem, sichtlich weicher gewordenem Kinn und middle-age-Bäuchlein unterm FILA-Top. Einer, der im Gegensatz zu den meisten Musiker*innen von Anfang an einen strategischen Überblick über dieses Business pflegte, spätestens seit er in den Spätachtzigern als Barkeeper im Portobello Hotel den dort abgestiegenen Bonos dieser Welt beim besoffenen Sinnieren über ihre Karrieren zuhörte.
Er und auch der Rest der Band weiß sehr gut, dass quirlig verschrobene, spitzwinkelige Songs wie „Villa Rosie“, „Stereotypes“ oder „Advert“, purer Punk wie „Popscene“, psychedelischer Noise wie „Oily Water“ oder die Coda von „Trimm Trabb“ eigentlich nichts in so einem Stadion-Rock-Set zu suchen haben sollten.
Aber sie spielen sie nicht bloß zwischen ihren populistischeren Hymnen wie „Girls & Boys“, „Country House“, „Parklife“, „There’s No Other Way“, „Song 2“ oder „Beetlebum“ (obwohl, bei welcher anderen Band gingen letztere beide Nummern schon als populistisch durch?), sondern brachial und ohne Schönung.
Wie überhaupt außer dem so gut wie unsichtbaren Keyboarder Mike Smith, einem Altherren-Brillen tragenden Phil Daniels bei „Parklife“ und dem London Gospel Community Choir beim tatsächlich unfassbar herzzerreißenden Handy-Lichtermeer-Soundtrack „Tender“ (Coxon sang seine „Oh my baby"-s nie besser) die Band ohne jede personelle Verstärkung auskommt. Ich habe Blur über die Jahrzehnte mit allerhand Bläsern, Streicherinnen und Chören spielen gesehen, aber dass sie sich ausgerechnet bei ihren bisher größten Gigs auf ein minimales Proberaum-Line-Up reduziert haben, scheint ebenfalls zu sagen:
Wir sind bloß diese kleine kunstige Band, die schon lange nicht zusammengespielt hat und durchaus ein bisschen ausgefranst klingt bzw. aussieht.
Mehr ist da nicht. Außer den Songs, die wir alle zusammen in den Köpfen tragen.
Die ganzen Arrangements als gemeinsame Geistertöne in allen unseren Köpfen.
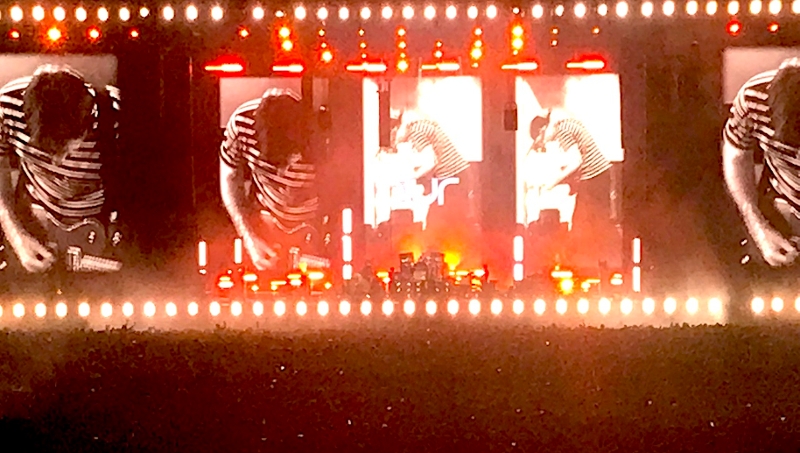
Robert Rotifer
Und so spielen Blur auch die großen Balladen wie „This is a Low“, „For Tomorrow“, „Out of Time“ oder „The Universal“ mit minimalen Backing Tracks (wenn überhaupt) und lassen dem Publikum den Platz, die fehlenden Töne mit versammelter Stimme und durch ihr bloßes Da-sein zu füllen.
So kann Stadion-Rock offenbar auch gehen. Hätte ich nicht geglaubt.
My little art-pop band, headlining @wembleystadium. pic.twitter.com/jYITqhe3a0
— Dave Rowntree (@DaveRowntree) 9. Juli 2023
Setlist vom Sonntag:
- St. Charles Square
- There’s No Other Way
- Popscene
- Tracy Jacks
- Beetlebum
- Trimm Trabb
- Villa Rosie
- Sterotypes
- Out of Time
- Coffee & TV
- Under The Westway
- End of a Century
- Sunday Sunday
- Country House
- Parklife
- To The End
- Oily Water
- Advert
- Song 2
- This is a Low
Zugabe:
- Lot 105
- Girls & Boys
- For Tomorrow
- Tender
- The Narcissist
- The Universal
Publiziert am 10.07.2023



















