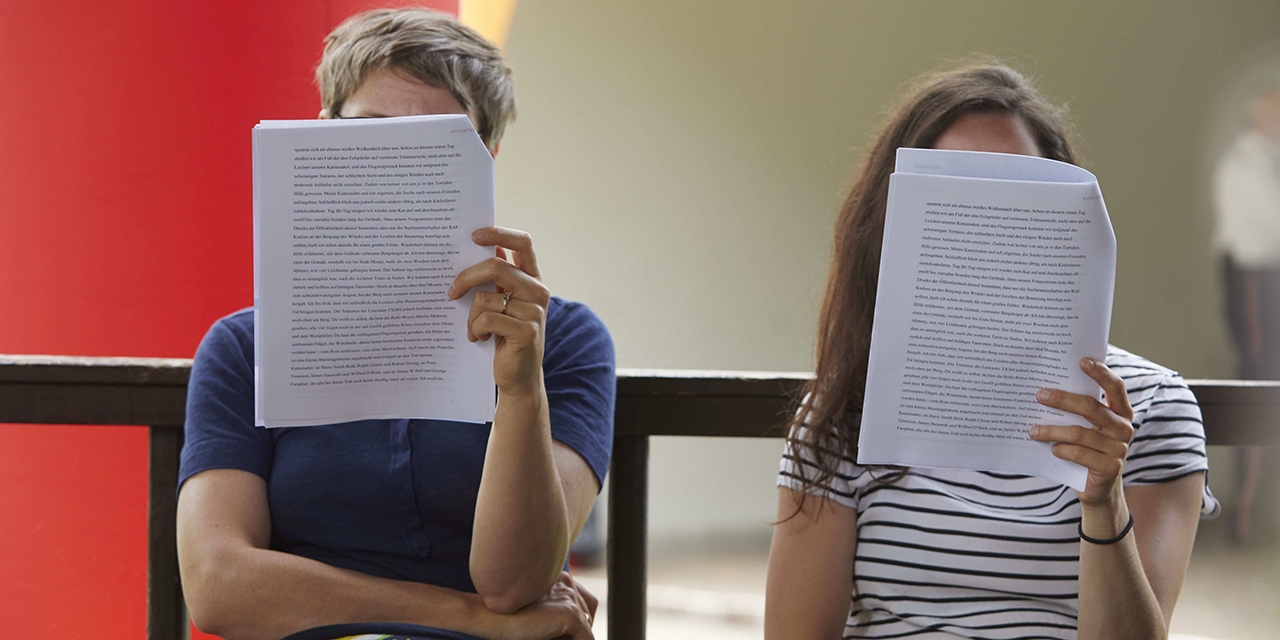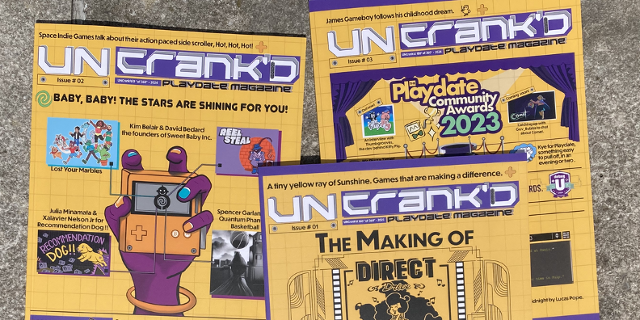Von der Love-Cam zu Zahnärztinnen-Porn
Von Maria Motter
„Klagenfurt ist ein Tribunal“, schreibt Daniel Kehlmann, Autor der Beststeller „Die Vermessung der Welt“ und „Tyll“, und mit Klagenfurt meint er den Bachmannwettbewerb. Wer sich vor die Jury setze, der habe „für eine ganze Weile, und vielleicht lebenslang, sein Recht verloren, sich über die Ungerechtigkeit der Kritik zu beklagen“, befindet Daniel Kehlmann im Standard.
Jetzt sind aber wieder wagemutige Schreibende da, die lesen wollen. Wie gerecht kann es überhaupt zugehen, wenn im Stundentakt unveröffentlichte Texte vorgelesen werden? Die Jurymitglieder kennen die Texte freilich schon, das Publikum hört sie zum ersten Mal.

ORF
Einmal blinzeln und die Wertung steht
Nach ungefähr 10 Millisekunden bewertet das Gehirn eine fremde Person zum ersten Mal. Nach 90 bis 150 Millisekunden ist unbewusst klar, ob wir die Person sympathisch finden oder nicht. Da macht es Sinn, dass alle Texte gleich formatiert sein müssen. Und der Eindruck ist ein anderer, wenn man den Text selbst in Händen hält: Vor Ort im Landesstudio Kärnten bekommen die ZuschauerInnen im Studio und beim Public Viewing im Garten den Text.
Mehr zuhörend als zuschauend fällt es am ersten Lesetag deutlich leichter, bei der Mehrzahl der bislang vorgetragenen Texte inhaltlich mitzukommen. Die Klammer „Romanauszug“ musste als Entschuldigung herhalten. Selbst der Jury war nicht immer klar, wer da wie und in welcher Konstellation welche Rolle hatte. Heute werde ich das Experiment wagen und schaue nur zu, mitlesen gilt dann mal nicht. Am ersten Lesetag ist die Perfomance der Kameramänner erstklassig.
Offizielle Kriterien, nach denen die Jury ihre Bewertung zu treffen hat, gibt es nicht. Aber jede und jeder hier hat eine Meinung zum Geschehen und das macht den Reiz des Bewerbs aus. Manche haben für sich Kriterien ausgemacht: So der Autor und Kritiker Philipp Tingler, der mit der Moderatorin der Schweizer TV-Sendung „Literaturclub“ mit Begeisterung fach-streitet. Auch das ist sehr amüsant anzuschauen. Gute Chancen bei der Jury hätten demnach Texte mit Ich-Perspektive, autobiografischem Bezug und Thematisierung der Zeit des Nationalsozialismus. Und dann hat Tingler noch zwei bizarre, doch nicht unwesentliche Kriterien ausgemacht:
Der Bachmannwettbewerb bedeutet vor allem eines: Aufmerksamkeit. Wie souverän die AutorInnen diese Unmittelbarkeit von ihnen fremden, neugierigen Menschen und die direkten Reaktionen auf ihr Schreiben bewältigen, bleibt unbemerkt. Im Fernsehen oder via Stream sieht man das nicht: Es ist alles sehr überschaubar hier vor Ort. Da stellen sich jene, die morgen lesen, in der Kantine um ein Stück Kuchen zu Mittag an, da suchen sich Eltern noch schnell einen Platz im Saal und die, die als Erste dran ist, wartet auf ihr „Jetzt bitte“. Wenn einmal ein Moment wäre für eine Panikattacke, dann jetzt, hat Moderatorin und FM4-Literaturressort-Leiterin Zita Bereuter vor den Lesungen gesagt und weiter: „Aber die Panikattacke, die kommt einfach nicht“.
Der Berg bricht
Raphaela Edelbauer hat schon einen Verlag für ihren noch unveröffentlichten Roman gefunden. Einen Auszug aus dem Roman hat sie als ihren Bachmann-Beitrag gewählt: „Das Loch“. Das wird auch sofort deutlich. Eine Ich-Erzählung alterniert mit Passagen zu den Morden an Zwangsarbeitern im Nationalsozialismus, die wie losgelöste Einschübe wirken.

ORF
Der Protagonist: Ein „Auffüllungstechniker“ bei der Arbeit in einem Berg und in einem kleinen Ort, in dem ein einstiges Nebenlager des Konzentrationslagers Mauthausen war.
Der Text in 3 Sätzen: „Wir möchten, sagte der Bürgermeister wie beiläufig, die Dinge nicht an die große Glocke hängen - auch wenn sich uns gewisse Problematiken und unerwartete Umstände mitteilten, sagte er, müssten wir diese nicht unbedingt in die Welt hinausposaunen, wozu im Übrigen ja auch weder Verpflichtung noch Anlass bestünde. Das Loch übte eine mesmerisierende Gewalt aus, ein kollektives Begehren. Es war ein eiskalter Morgen, mit Temperaturen kaum über dem Gefrierpunkt, und die verbleibenden achthundert Männer standen ohne Schuhe im letzten Schnee.“
Das sagt die Jury:
Die Figur des „Auffüllungstechnikers“ sei „ein bisschen daneben gestellt“, findet auch Hubert Winkels. „Du könntest bei diesem Thema sehr leicht zu weit gehen oder nicht weit genug“, sagt Stefan Gmünder und lobt den für ihn „sehr gelungenen Text“. „Es gibt recht viel, was da an Füllmaterial eingespritzt ist – um in dem Vokabular zu bleiben“, sagt Michael Wiederstein. „Hätte man nicht im Sinne der Statik dieses Textes“, setzt Neo-Jurorin Insa Wilke an mit Verbesserungsvorschlägen an den Text an und wendet sich an Klaus Kastberger, der die Autorin Raphaela Edelbauer zum Bachmannlesen geladen hatte, um Erklärungen. Kastberger hebt jenen Satz hervor, in dem Raphaela Edelbauer erzählt, dass Pferden die Augen ausgestochen wurden, sie blind gemacht wurden, weil sie sonst die Bergwerksarbeit gescheut hätten. „Ich finde den Text ganz stark, ich finde ihn super“, urteilt Nora Gomringer, die erstmals in der Jury ist.
Am Plattenspieler: „Ich verkeile mich frühmorgens in tiefer Kniebeuge auf dem Fels über der Stadt, um planmäßig in ihm einzufahren, während Billie Holiday aus meinem Handy singt.“
Bild der geblendeten Grubenpferde kenn ich aus Zola „Germinal“, ganz traurige mehrseitige Beschreibung dort, wird man halb wahnsinnig davon #tddl
— clemens setz (@clemensetz) 5. Juli 2018
Eine Untote oder ein Kokon am Ende
Die Schweizerin Martina Clavadetscher tritt mit dem Text „Schnittmuster“ an.
Die Protagonistin: Störschneiderin
Luisa, 92, sterbend und dann untot, spricht trotz ihres Ablebens weiter zum Leser und berichtet von ihrer Ver- und Entpuppung zu einem seltsamen Getier.
Der Text in 3 Sätzen: „Meinetwegen, macht noch ein Gehäuse ums Gehäuse. Als hätte mich der Körper nicht schon zweiundneunzig Jahre lang eingeschachtelt. Sie brechen ihr die Starre aus den Gelenken, damit das Sperrige ins kleine Schwarze passt, damit sie nochmals zur Schönheit wird. Im Nachhinein ist man immer schlauer - dafür auch tot.“
Im Duden nachgeschlagen: Tarsus
Das sagt die Jury:
Die Metaphorik sei am Ende überfrachtet, findet Michael Wiederstein. Den Anfang des Texts macht Klaus Kastberger als den besten Anfang beim diesjährigen Lesen aus: „Das letzte Schnappen macht den Unterschied“ ist für den Grazer Juror der beste erste Satz.
Insa Wilke merkt an, dass interessanterweise in diesen Tagen in vielen Texten die Frage auftaucht, warum Gewalt nicht abnehme, sondern tradiert werde.
Hildegard Keller sieht eine „Erzählung der letzten Chance“, die sie sehr eingenommen habe: Es sind zwei Perspektiven drinnen, innen und außen. Für Stefan Gmünder indes ist der Text über-instrumentalisiert und zu voll von sprachlichen Versatzstücken. Insa Wilke hätte sich eine Reibung im Text gewünscht.
Der „Intertronic – Micro Cassette Recorder“ spielt: Oral-History-Aufzeichnungen einer 92-Jährigen im Gespräch mit ihrer Enkelin.
Mehr als das N-Wort im Text
Der Schauspieler und Autor Stephan Lohse legt den Text „Lumumbaland“ vor. Darin fühlt sich ein weißer Jugendlicher als Schwarzer, die Freunde nehmen das zur Kenntnis. Kolonialgeschichte und Identitätsfindung korrelieren sehr unterhaltsam.
Der Text in drei Sätzen (zugleich der lustigste Dialog des ersten Lesetages): „Lumumba ging die Sahara hinunter, stellte einem der Penner einen Becher Eiersalat auf den Beton und weckte ihn: »Würdest du was ändern, wenn du könntest?« »Ich würde dir in die Fresse hauen, wenn ich könnte.« »Und würdest du vorher einen Eiersalat haben wollen?«
Das sagt die Jury:
Hubert Winkels spricht das N-Wort aus, ohne den Satz zu zitieren, in dem es im Text vorkommt. Hallo?! Wo sind wir da? Alles dreht sich hier um Sprache und dann diese Unbedachtheit. Wäre es ein Zitat gewesen, wäre das Mitsprechen von Anführungszeichen notwendig. Klaus Kastberger findet die historischen Bezüge im Text bildungsbürgerlich und überflüssig. "Könnten alle, die etwas über Lumumba wissen, bitte die Hand heben?“, wendet sich Neo-Jurorin Insa Wilke umgehend ans Publikum. Genau: Der Freiheitskämpfer Lumumba ist den wenigsten ein Begriff. „Lumumbaland“ ist definitiv ein Text, zu dem ich gleich die Fortsetzung lesen würde. Aber Stephan Lohse hat andere Pläne.
Warten auf den Roman
Anna Stern liest ihren Romanauszug „Warten auf Ava“ im Stehen an einem Pult.
Plot: Er ist kompliziert und führt an die Absturzstelle einer Flugmaschine. Zu der tatsächlich Schaulustige wandern.
Der Text in drei Sätzen:
„Clodagh Swann setzt sich zu Ava ans Bett und sagt, ach Ava, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wie konntest du bloß auf die Idee kommen, bei diesem Wetter allein zu Coire Mhic Fhearchair aufzusteigen und von da aus weiter, um das Loch und die Flanken der Triple Buttresses hinauf. Es ist Nacht, ein, zwei, vielleicht drei Uhr, die Zeit hat alle Bedeutung verloren.“

ORF
Das sagt die Jury: Als sie den Text zuhause gelesen hat, ist Insa Wilke dem Text nicht auf die Spur gekommen. Jetzt, bei der Lesung habe sie realisiert: Es geht um sechs Arten, mit Trauer umzugehen. Stefan Gmünder denkt an literarische Frauenfiguren des 11. und 12. Jahrhunderts. „Der Text und ich sind Freunde geworden“, sagt Hildegard Keller und fasst zusammen, was sie als Plot ausgemacht hat. Es ist eine „eine Parade der Menschen, der Beziehungsgeflechte“.
Aus dem Funkgerät: keine Musik, sondern Rezitation von Gedichten von Franz Wright.
Die Kiss-Cam läuft
Joshua Groß liest seinen Text „Flexen in Miami“
Plot: Boy-meets-girl in Miami. Selfies und Drogen, Küssen, Kotzen und über BSE labern. Dann noch angedeutete Aufenthalte in einer Psychiatrie. Einmal darüber wie Zuckerstreusel ein Zitat Wolfgang Borcherts: “Wir selbst sind zuviel Dissonanz.“ (Aus Borchert: „Das ist unser Manifest“).
Der Text in drei Sätzen: „Dann zeigte sie mir, was sie posten würde, und wir schauten beide auf den Bildschirm, auf die, die wir nicht waren, wahrscheinlich, um uns selbst nicht ansehen zu müssen. Ich kannte meine Neigung zur spekulativen Romantik, die nach Begegnungen wie dieser in tagelangem Phantomliebeskummer endeten, in Überwerfungen mit mir selbst und hoffnungslosen Facebook-Recherchen. Ich las den Wikipedia-Eintrag zu Wolken.“
Aus Stadion-Boxen: „Es lief Survivor von Destiny’s Child, aber chopped und screwed.“

ORF
Das sagt die Jury: „Mit BSE kriege ich Probleme“, sagt Stefan Gmünder. Nicht nur er. Angetan indes sind der Jury-Vorsitzende Hubert Winkels und Hildegard Keller. Keller macht „Spiellust mit Bewusstsein“ aus. Insa Wilke findet die Sprache „wahnsinnig witzig“. Der Text funktioniere intuitiv. In dieser technischen Innovationswelt leben wir seit einem Vierteljahrhundert, wendet Winkels ein. „Diese Kaugummi-Nike’s-Dekadenzliteratur kennen wir von der frühen und der späten Popliteratur“, Wiederstein. Definier’ einer „Hippie“!
Texte mit diesen moralisierenden Botschaften müssen OberstufenschülerInnen ständig lesen und bei der Zentralmatura erörtern, kommentieren, empfehlen. Gähn-Emoji. Ein Text für Großeltern, die noch ein iPad zu ihren Geburtstagen geschenkt bekommen haben. Besser, man greift zu Günther Anders Werken – die hatten diese Medienkritik schon in den 1970ern treffend.
Wer verschiebt jetzt seinen nächsten Kontrolltermin?
Bizarre Minuten am zweiten Lesetag. Autorin Corinna T. Sievers ist Zahnärztin in Zürich. „Der Nächste, bitte!“ ist der Titel ihres Textes und das Publikum verfolgt die Lesung wie unter Lokalnarkose. Dabei werden wir hier mit allerlei sexuellen Begriffen penetriert.
Die Hauptfigur: Die Ich-Erzählerin ist Zahnärztin und legt sehr steril und pornografisch Gedanken über Männer und Sex offen.
Der Text in drei Sätzen: „Auf dem Zahnarztstuhl. Wir sprechen davon, dass das gegenseitige Einvernehmen abzuklären einer Herausforderung gleich komme, vielleicht der größten. Woher ich weiß, dass K.s Patientenschwanz steif ist, kann ich nicht erklären.“
Das sagt die Jury:
Wie Bericht an eine Akademie, sagt Hubert Winkels zur Sprache- Sex wird nur in dem Moment, in dem er geschieht und ist ein Abweichen von der Norm.
Wie kann man überhaupt über Lust sprechen? Freud wird zitiert. Hier haben wir einen Versuch, das in einer fast akademischen Form zu tun. Hildegard Keller ist der Text nicht radikal genug, weder inhaltlich noch sprachlich. „Relativ gemocht“ hat Stefan Gmünder den Text. Insa Wilke macht das Thema Ekel aus. Für Nora Gomringer, die Sievers zum Bewerb geladen hat, ist es eine immens lustige Geschichte. Klaus Kastberger hat sich gefragt, worin der Unterschied zwischen einer weiblichen Erotomanin und einem Macho läge. Jelineks „Lust“ wäre ein Klassiker der österreichischen Literatur, der versucht, weiblichen Porno zu begründen, informiert Kastberger. „Der Text hat mich Gott nicht näher gebracht und ich weiß jetzt, wo Kinder gemacht werden und wo nicht.“ Wilke bringt einen interessanten Exkurs zur historischen juristischen Beurteilung von lesbischem Sex, der viele Jahre nicht als solcher anerkannt wurde.
Im Duden nachgeschlagen: atrophieren
Publiziert am 06.07.2018