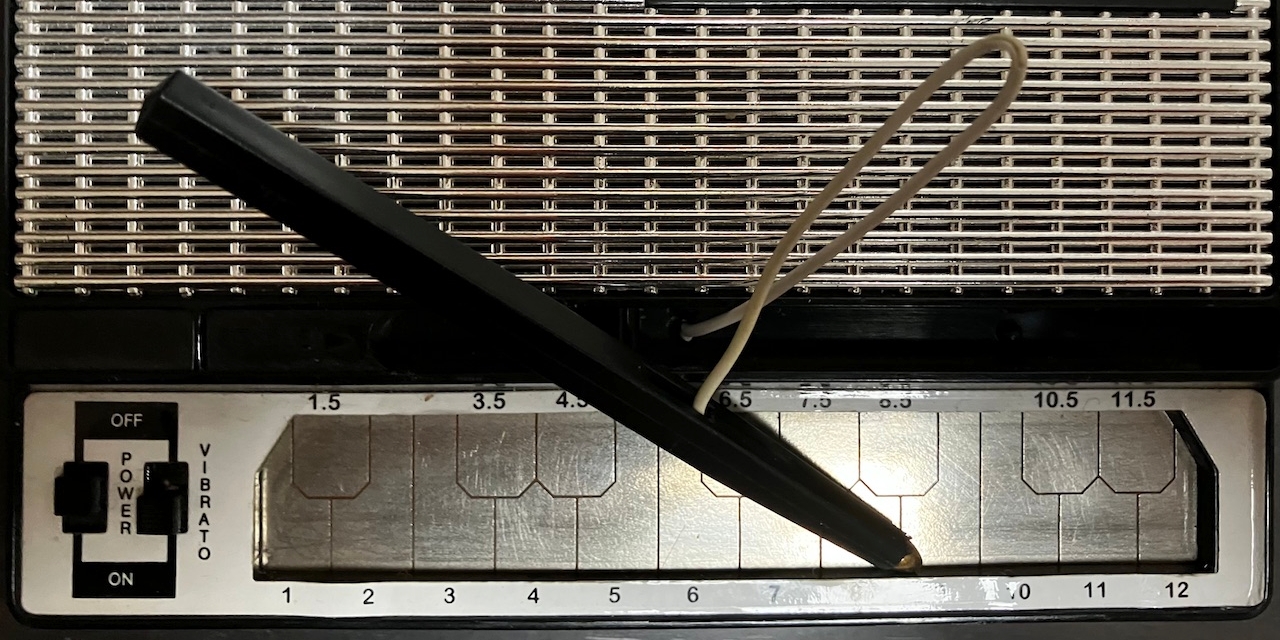Stream Baby Stream
Eine Kolumne von Robert Rotifer
Es war neulich, nein vor zwei Wochen, da machte mich die Redaktion darauf aufmerksam, dass laut einem CNN-Bericht die galoppierenden Vinyl-Preise die britische Inflationsrate verzerrt hätten.
Die Närr:innen des Office for National Statistics hatten offenbar tatsächlich gedacht, sie könnten ein bisschen mehr groovy aussehen, wenn sie dieses Vinyl-Revival berücksichtigen, von dem man überall hört.
Also haben sie zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten wieder Schallplatten mit in den zur Berechnung der Preissteigerungsrate verwendeten, metaphorischen Warenkorb geworfen.
Dabei weiß jede:r, die oder der Platten kauft und/oder spielt (nicht dieselbe Gruppe von Leuten), dass sich aus den Preisen für Vinyl dieser Tage gar nichts Sinnvolles ablesen lässt. Außer vielleicht, wie die Popkultur heute die immer mehr ins Himmelschreiende wachsende Ungleichheit der Welt reflektiert. An sich ja in Ordnung, Popkultur reflektiert immer, was in der Welt passiert. Aber es ist trotzdem auch ein Bruch ihrer historischen Praxis, denn am konkreten Beispiel heißt das:
Eine Taylor-Swift-LP kostet im britischen Handel derzeit umgerechnet 47 Euro. Als bei weitem meistverkauftes Vinyl-Produkt ist so eine LP in der Herstellung wesentlich billiger als Konkurrenzprodukte mit kleineren Auflagen. Der absurd hohe Preis ist also entweder davon bestimmt, womit das Label glaubt, davonkommen zu können, oder - was ich eher glaube - seinerseits schon Teil des Fetisch/Maßstab der Aufopferung.
Und falls Boomer:innen oder Gen-Xers jetzt glauben, das sei eine Gelegenheit, sich den jungen Swifties überlegen zu fühlen, dann sag ich nur: Für das Vinyl-Reissue von „Harvest“ von Neil Young will HMV ganz ohne Scherz umgerechnet 70 Euro.
Für solche Dinge wurde der Hashtag #vinylstupidity erfunden. Aber es ist eben nicht bloß Blödheit, sondern die Welt, in der wir leben, sprich: Umverteilung nach oben auf allen Linien.
Neulich veranstaltete ein Haufen Indie-Labels im Londoner Betsey Trotwood einen Label-Markt, und dort hätte es niemand gewagt, mehr als 20 bis höchstens 25 Pfund für eine LP zu verlangen. Nicht aus Bescheidenheit, sondern weil bei aller Liebe niemand mehr zahlen würde. Ja mehr noch: Wer dort mehr verlangen würde, wäre eindeutig das Arschloch.
Der Vorteil an meiner fortgeschrittenen Annäherung ans eigene Grab ist nun, dass ich euch fundiert versichern kann: Das war nicht immer so! Im Gegenteil, populäre Tonträger und schon überhaupt Reissues („Nice Price“) waren früher im Diskont zu haben. Indie-Platten waren oft einen Deut teurer als Charts-Material, entsprechend den höheren Produktionskosten bei niedrigeren Auflagen. Der demokratisierende, anti-elitäre Triumph der Popkultur war es, dass ein billiges Stück Kunst, geliebt von Millionen, mehr Geld machen konnte als ein teures Stück Kunst, geliebt von einer reichen Sammler-Elite.
Aber das waren eben auch noch Zeiten, wo man zum Beispiel davon ausging, dass gewöhnliche Leute halbwegs anständig bezahlt gehören, damit sie auch ein bisschen was an Kaufkraft aufbringen können. Sie hatten dann genug Geld, um sich Platten zu kaufen, mit Songs drauf, die Kritik an der Konsumgesellschaft übten.
Zum heutigen Markt für Konzertkarten und Vinyl-Platten, wo dort die Preisexzesse stattfinden und was das aussagt, fiele mir noch einiges ein. Aber der Nachteil an meiner fortgeschrittenen Annäherung ans eigene Grab ist, dass einiges davon als die Bitterkeit eines alten Mannes ausgelegt werden würde. Also lassen wir das lieber.
Allerdings bin ich ja jetzt endlich bei der Sache angelangt, von der ich euch eigentlich erzählen wollte: Es gibt ja nämlich den einen Bereich in diesem völlig verbockten Business, der zumindest an seinem Konsument:innen-Ende noch egalitär aussieht: Streaming natürlich.
Ihr zahlt euren monatlichen Beitrag und könnt dafür werbefrei um denselben Einheitspreis Taylor Swift, Neil Young (ja, er hat seinen Spotify-Boykott gerade aufgegeben) und irgendwelche, statistisch unerhebliche Indie-Acts hören.
Am anderen Ende, wo den Künstler:innen ihr Anteil an dem großen Pool von Abo- und Werbe-Einnahmen ausgezahlt wird, zeigt das 21. Jahrhundert dagegen seine gewohnte Grimasse und bleckt die Silberzähne der klaffenden Einkommen- und Vermögensschere.
Ich spreche da jetzt nicht einmal davon, dass die gute Taylor sich mit ihrem zweijährigen Spotify-Streik einen individuell besseren Deal aushandeln konnte. (Damals überall so berichtet, als würde das auch die Verhandlungsposition anderer Künstler:innen stärken. Aber was überall so berichtet wird, ist in diesem Bereich besonders verlässlich Blödsinn.)
Vielmehr beziehe ich mich auf die Ende letzten Jahres überall (verlässlich blödsinnig) als Kampf gegen KI-Fake-Musik berichtete, seither einseitig durchgezogene, „künstlerzentrierte“ Bezahlungsreform bei Spotify (ähnlich auch Deezer). Derzufolge muss ein Track pro Jahr über 1000 Zugriffe erreichen, um überhaupt honoriert zu werden.
Angesichts von durchschnittlich 0,003 bis 0,004 Euro pro Stream, die an einen Act bezahlt werden (je nach Deal kann es auch weit weniger sein), wäre das an sich relativ egal. Nicht ganz so, wenn etwa ein Label viele Alben mit vielen einzelnen Tracks im Katalog hat, die jeweils ein paar hundert Mal im Jahr gestreamt werden.
Und schon gar nicht vom Prinzip der Fairness her.
Schließlich zahlen Leute, die zum Beispiel über ein Online-Label ihre Songs digital veröffentlichen, rund zehn Euro für das Privileg. Die würden sie auch zurückkriegen, wenn ein paar Tracks ihres Albums in den höheren Hunderten streamen. Mit der neuen Regelung wird ihr Beitrag dagegen zur Spende an Besserverdienende. Denn was der Streaming-Dienst sich am unteren Ende des Markts an Mikro-Auszahlungen erspart, wird an die illustre Minderheit am Streaming gut verdienender Artists weitergeleitet.
Ich spüre schon in meinen tippenden Fingern, wie beim bloßen Nennen solcher Bagatellbeträge die Augen der Lesenden ermüden, aber in der großen Gesamtheit spielt das tatsächlich eine ziemlich große Rolle im Machtgefüge der Musikindustrie.
Und deshalb will ich hier – „Cross-Promotion“ nennt man das bei uns – auf eine Serie hinweisen, die ich für unseren Schwesternsender Ö1 produziert hab: „Die Rebellion gegen das Online-Musik-Monopol“ heißt sie ziemlich reißerisch, sie läuft seit Montag und bis Donnerstag.
Zu hören sind darin Ausschnitte meiner stundenlangen Gespräche mit Leuten wie Sophia Blenda, Bernhard Eder, Sanna Lu Una, Hannes Tschürtz von Ink Music, Amelia Fletcher von Swansea Sound, Talulah Gosh und der britischen Competition and Markets Authority, Michael Holzgruber von den Sofa Surfers, Mareile Heineke vom Streaming-Service Qobuz, Michael Lachsteiner von Blankton, Dario Draštata von der Indie-Label-Pressure Group IMPALA und Ben Sorgenfrei von der Musik-Promotion-Agentur Mosaik. Alle davon haben ihre eigene, hörenswerte Perspektive auf die Sache.
Spotify wollte ja interessanterweise nicht mit mir sprechen.
Es geht also um den marktbeherrschenden Terror der Playlists bzw. die Macht der Algorithmen. Den heiklen Umstand, dass die Major-Labels (eigentlich vor allem die Universal Music Group), die in ihren Lizenzverhandlungen mit den Streaming-Riesen die für alle anderen geltenden Voraussetzungen bestimmen, spezifische Interessen vertreten: Erstens als Besitzer des historischen Katalogs an etablierten, von Algorithmen bevorzugten Hits, zweitens als Teilhaber an den Streaming-Diensten selbst (die Ökonomin Fletcher spricht von einer „Kartellisierung durch die Hintertür“, Michael Lachsteiner spricht von „mafiösen Strukturen“).
Während der Recherche wurde mir aber auch klarer, wie sehr die Beurteilung junger Artists über Follows, Likes und Plays heutzutage eine de facto-Pflicht zur Social Media-Neurose bedeutet.
Ohne eine Mindestzahl von Listeners gibt’s keine Bookings, daher der Zwang zum dauernden Füttern des Algorithmus durch neue Veröffentlichungen und permanente Selbstdarstellung auf sozialen Medien, begleitet von ständigen Angstzuständen und Minderwertigkeitsgefühlen beim Checken der Stats. Und dazu noch die Krücke schnell gekaufter Klicks, gefolgt von noch mehr Selbstzweifeln, wenn sich die bezahlten Likes der Phone Farms aus Fernost nicht in wahre Popularität übersetzen.
Ferner geht’s darum, wie alte Songs sich via geklonter Playlists zu Dauerbrennern auswachsen können, ohne dass deren Hörer:innen wissen oder wissen wollten, wer sich dahinter verbirgt.
Wie beim sogenannten Playlist Pitching ausgerechnet Algorithmen beurteilen, ob das statistisch erfasste Interesse von Hörer:innen und Fans am jeweiligen Act auch wirklich ein glaubhaft menschliches ist.
Wie es andererseits auch keine menschliche Alternative zu jenen Algorithmen gibt, zumal täglich 60.000 neue Songs auf Spotify veröffentlicht werden, die buchstäblich kein Mensch mehr anhören kann.
Und schließlich um mögliche Alternativen zu Spotify & Co., von User-zentrierten Modellen bis zu alternativen Streaming-Portalen (ich zum Beispiel bin durch die Recherche selbst zum Qobuz-Nutzer geworden).
Hoffe also, es ist mir gelungen, ein Thema hörbar zu machen, von dem keiner so genau was wissen will, solange die Musik spielt (nach meiner Erfahrung wollen nicht einmal die selbst Ausgebeuteten allzu viel davon wissen, weil sie sich sonst dumm vorkämen).
Man kann’s nachhören, bei den Kolleg:innen von Ö1:

Robert Rotifer
Hitmaschine
Publiziert am 27.03.2024